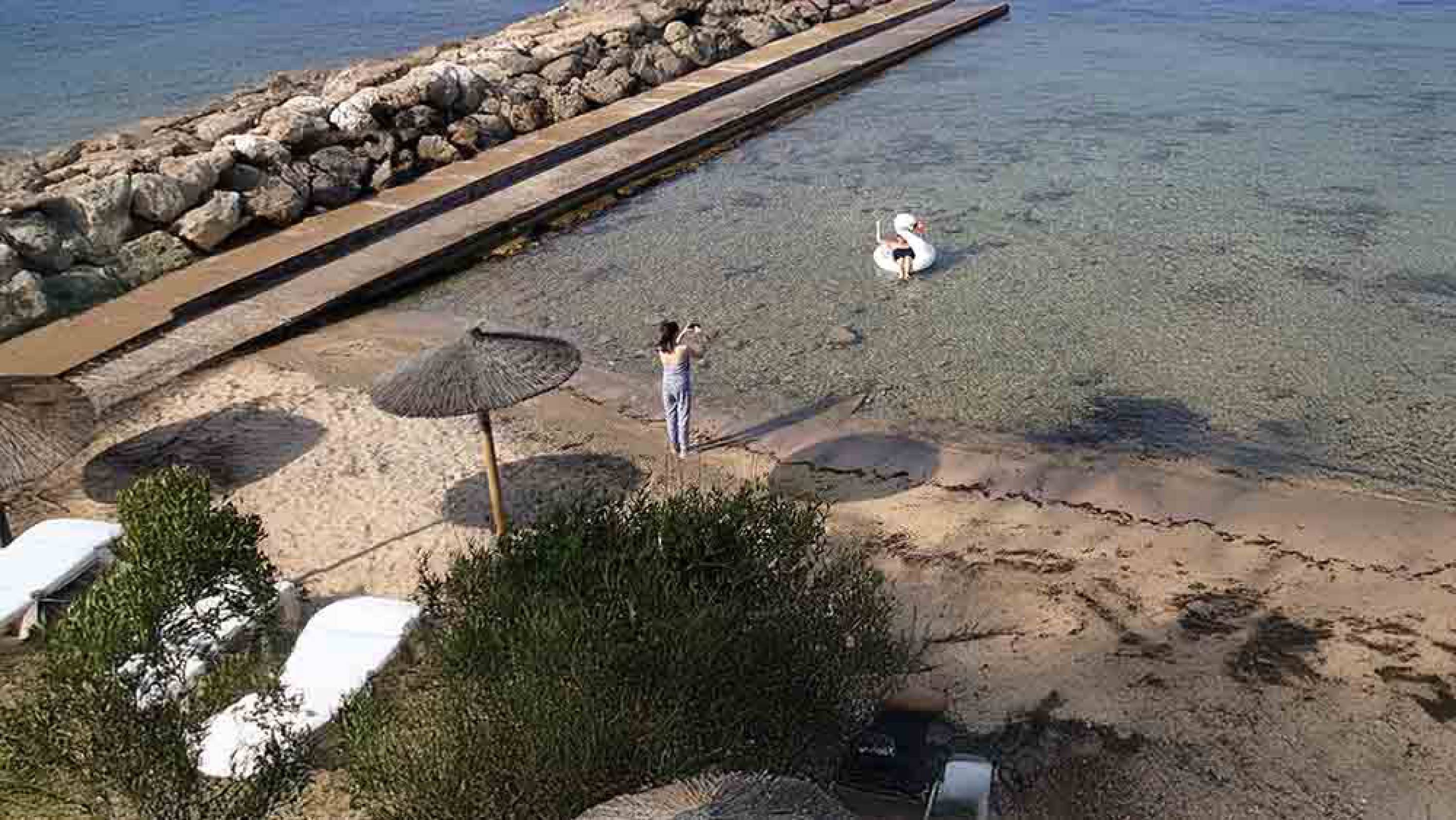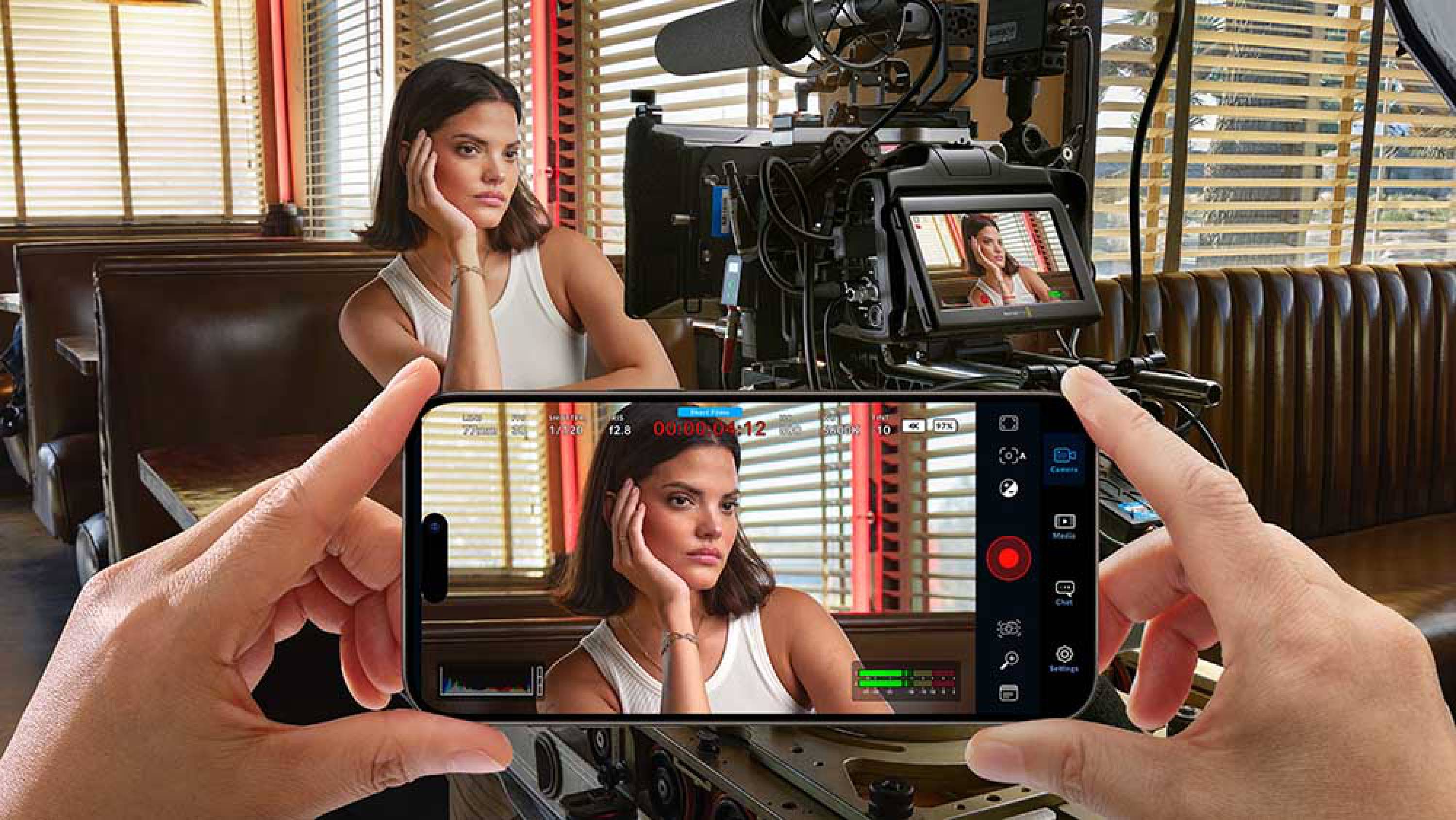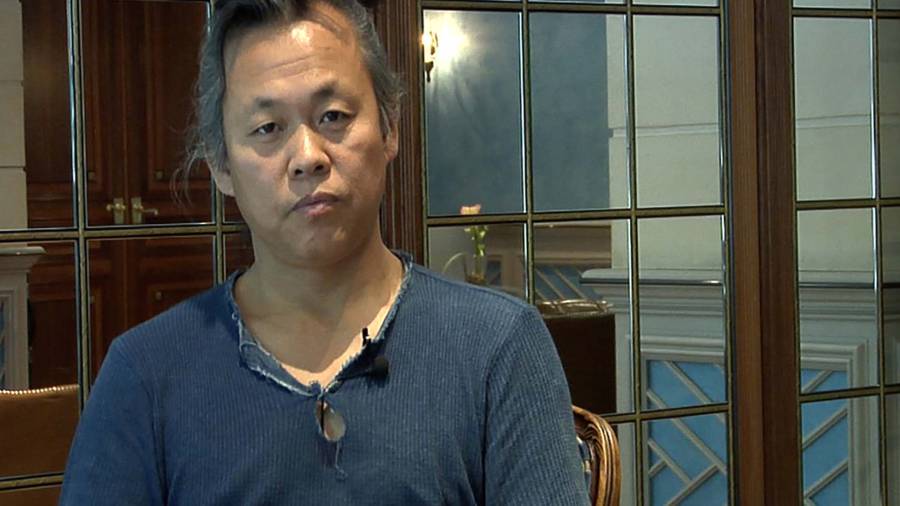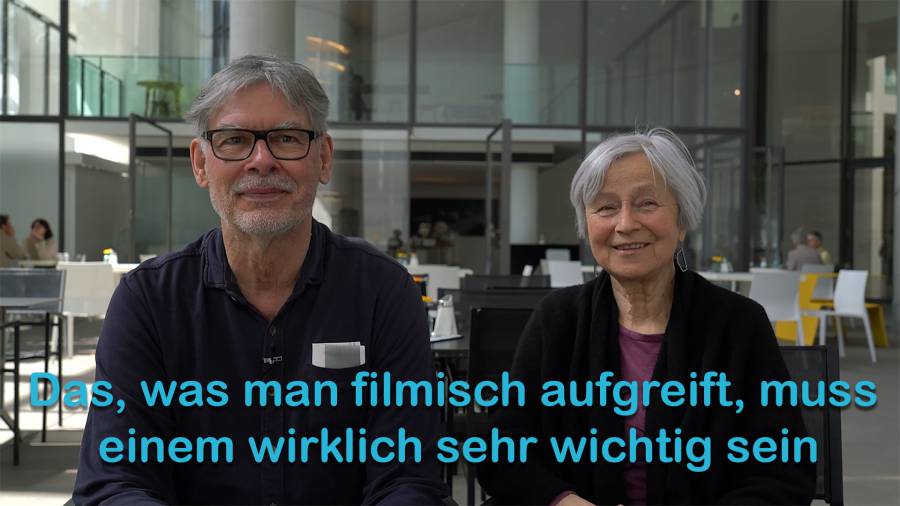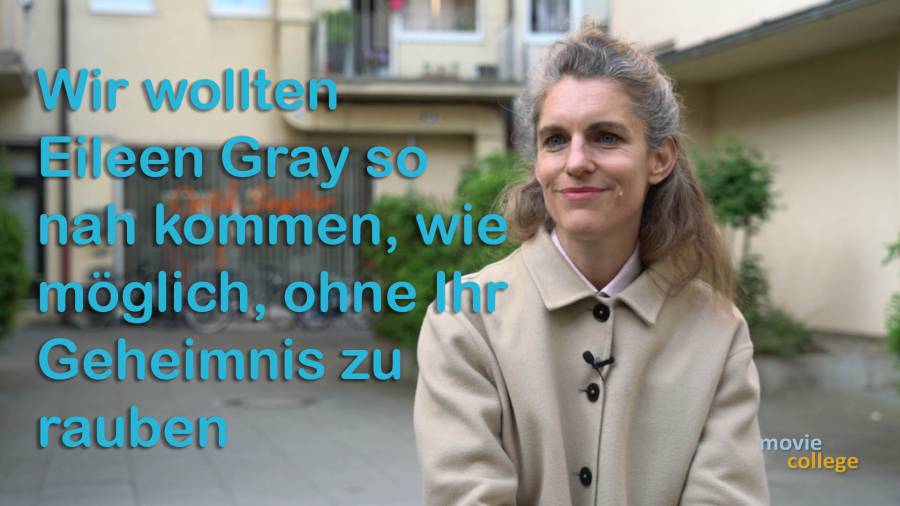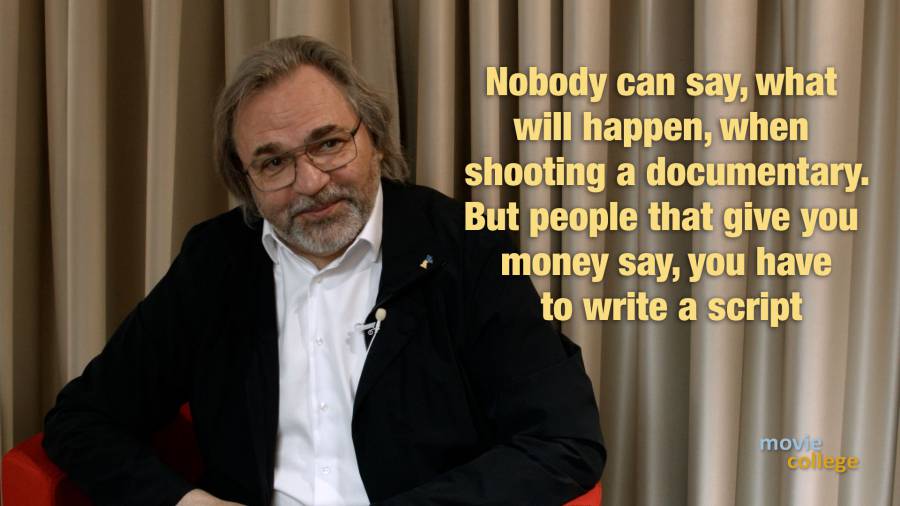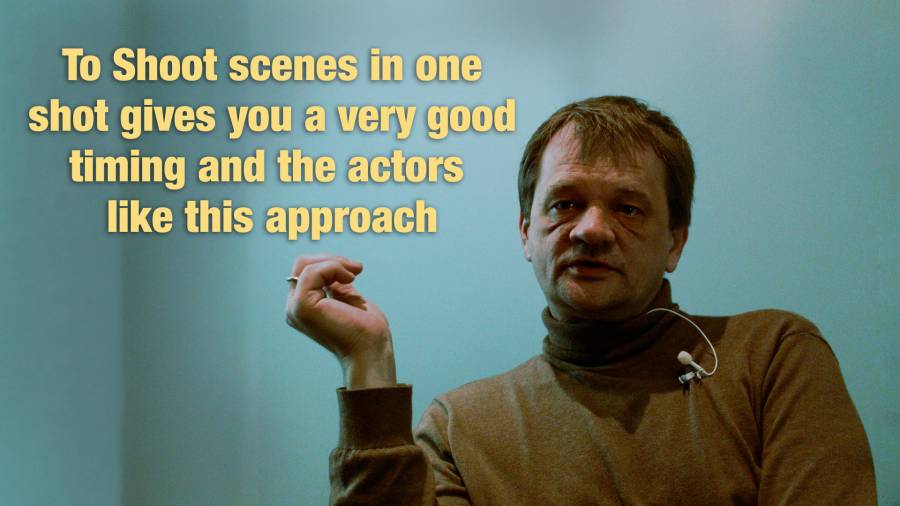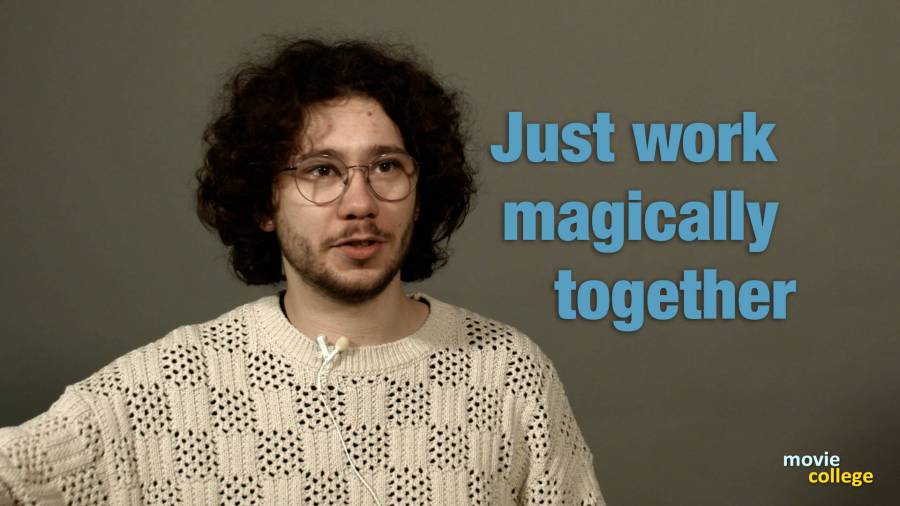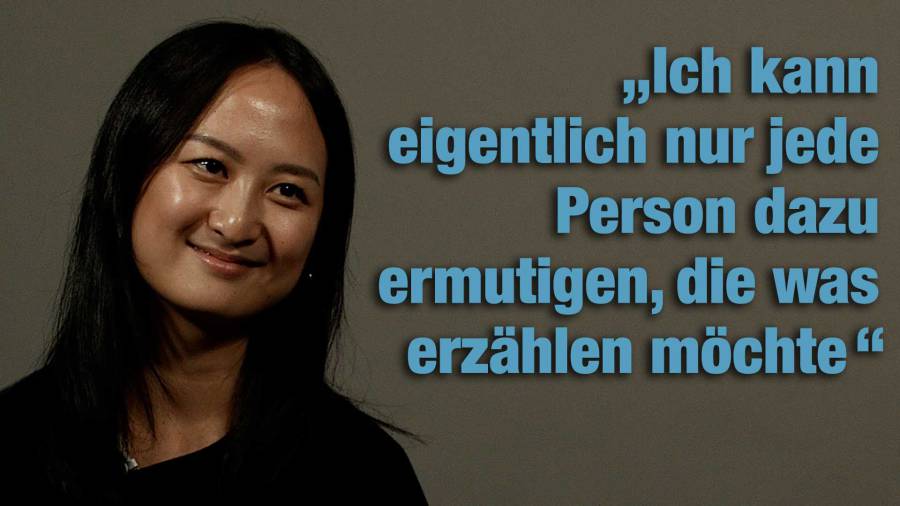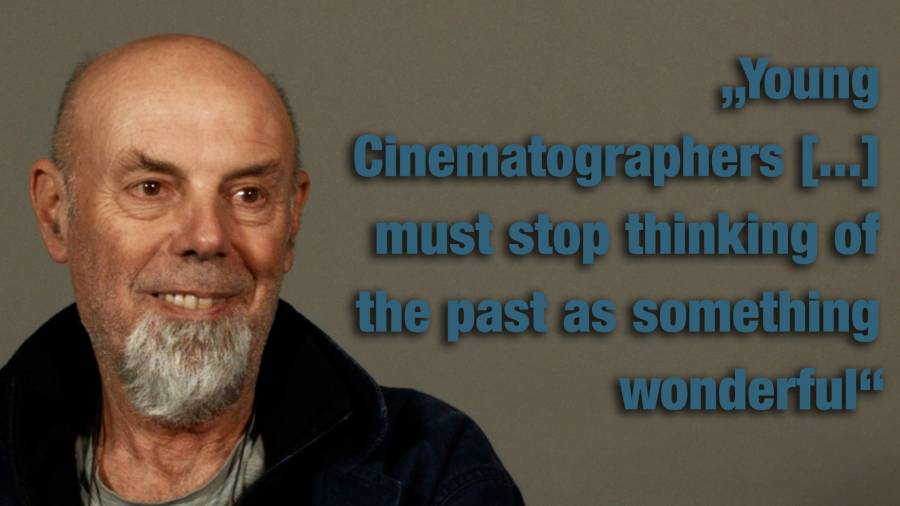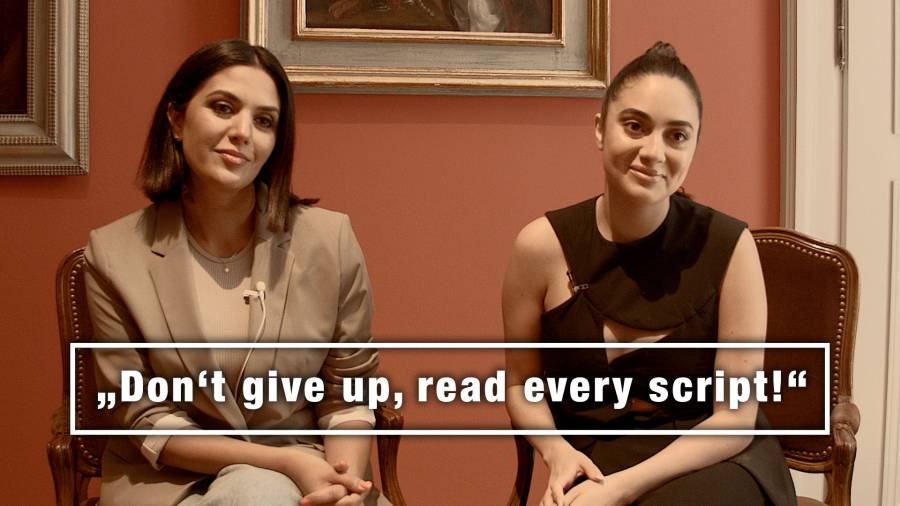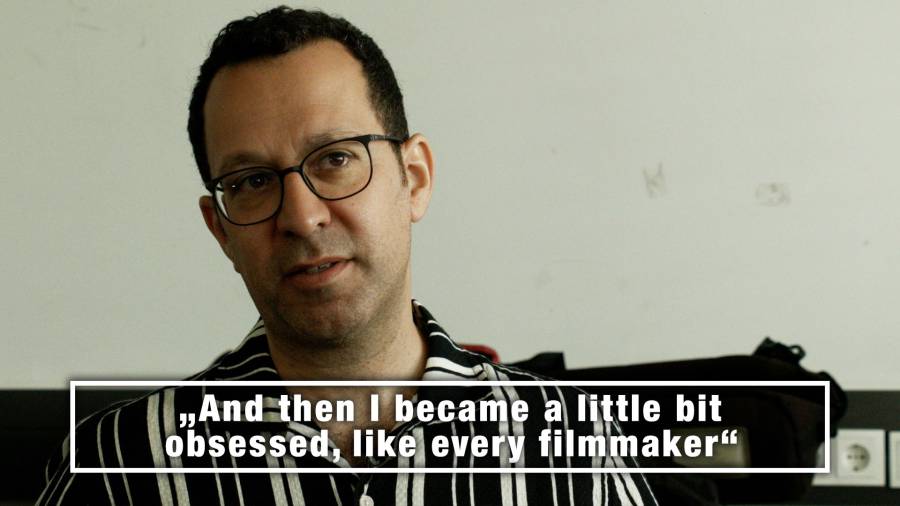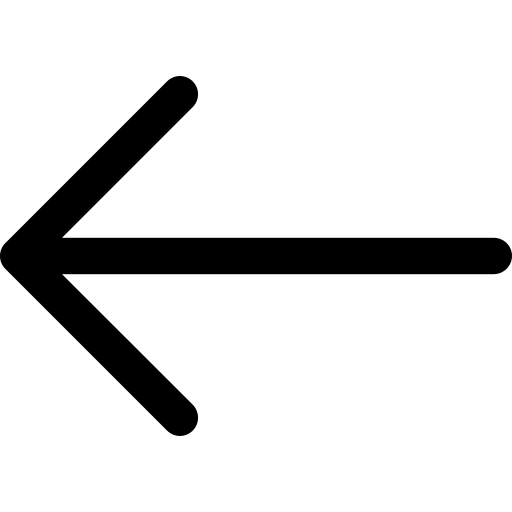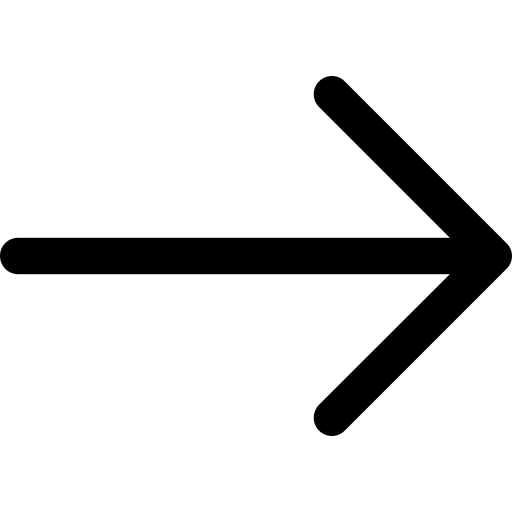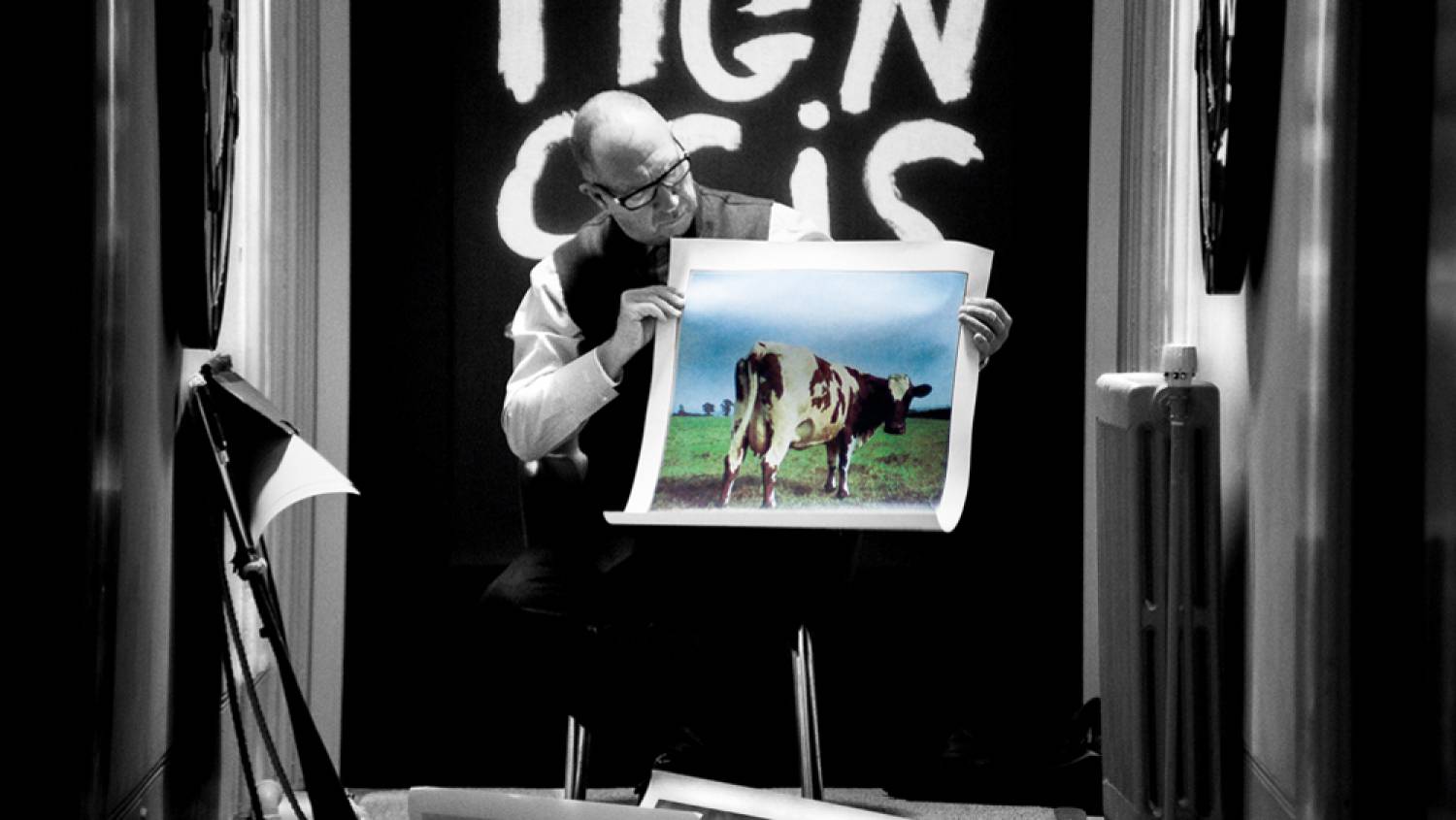Open menu
- Aktuelles
- Neue Artikel
- Tech-News
- Festivals
- Filmkritiken
- Filmpreise Europa
- Filmpreise Welt
- Kongresse & Foren
- Themen-Archiv
- Neue Gadgets
- Filmgedanken
- Video-Blog
- Filmschule: Kapitel
- Wettbewerbe
- Stipendien
- Filmschule
- Animation
- Drehbuch
- Übersicht: Drehbuch
- Ideenklau
- Schreiben
- Grundregeln
- Charaktere
- Suspense
- Wichtiges vorab
- Drehbuch-Struktur
- Dialoge
- Motivwahl
- Erzählperspektive
- Der Schluss
- Genres
- Spannungsbogen
- Cliffhanger
- Drehbuch-Software
- Drehbuch: Eigene Erlebnisse
- Drehbücher für Serien
- Hindernisse - gut fürs Drehbuch
- Drehbuchschreiben mit KI
- Plot oder Character-Driven?
- Vielfältiges Erzählen
- Vermarktung
- Äußere Form
- Drehbuchautoren
- Ideen sammeln
- Motivation
- Stoffentwicklung
- Exposé
- Treatment
- Dramaturgen
- Soderbergh´s Story-App
- Klischees im Film
- Drehbücher
- Outline, Logline
- Dokumentarfilm
- Übersicht: Dokumentarfilm
- Dokumentaristen
- Miklós Gimes
- Ursula Scheid
- Dan Geva
- Jamie Kastner
- Matthias von Gunten
- Mahnaz Afzali
- Blümner & Siegel
- Sudabeh Mortezai
- Mesmer Mikima
- Maldonado & Sülzle
- Pennebaker
- Christian Frei
- A. und El Sharkawy
- Bience Pilavci
- Sourav Sarangi
- Volker Koepp
- Nikolaus Geyrhalter
- Assaf Lapid
- Victor Kossakovsky
- Petra Lataster-Czisch & Peter Lataster
- Doku-Erbe Moore
- Interviewtechniken
- Doku und Sicherheit
- Pressekodex
- Klima-Filme
- Cinéma Vérité
- Direct Cinema
- Dokutainment
- Grundsätze
- Stuttgarter Schule
- DOKFest München
- Presseausweis
- Doku-Fake
- Grenzen des Zeigbaren
- Echtzeit 24h Bayern
- VJ Jobangebote
- Archivaufnahmen
- Authentizität
- Dokumentarfilm & Kino
- Filmausbildung
- Übersicht: Filmausbildung
- Workshops
- Filmschulen
- Berufsbilder
- Praktika
- Verbände
- Filmland: Schweiz
- Filmland Österreich
- filmArche Berlin
- Medienhochschulen
- Fachoberschulen - Gestaltung
- Studium Journalismus
- Ausbildung im Ausland
- Notfall e-learning
- Fotografie als Job
- Filmberufe & Eltern
- Regisseur*In werden
- Filmgestaltung
- Filmtheorie
- Produktion
- Übersicht: Produktion
- Drehplanung
- Strom im Ausland
- Drehen USA
- Dispo
- Dispo: 12.Tag
- Stab Positionen
- Drehorte
- Akkus im Flugzeug
- Set-Heizungen
- Catering
- Produzieren in Frankreich
- Vorsicht Dreharbeiten
- Dreh in Tanzania
- Film-Commissions
- Waffen am Filmset
- Sicherheit an Filmsets
- Drehpensum
- Drehs an Urlaubsorten
- TV Auftragsproduktionen
- Szenen mit vielen Komparsen
- Finanzierung
- Kalkulation
- Producer-Tätigkeit
- Drehort: Weggedreht
- Imagefilme
- Film-Desaster
- Rechte
- Verträge
- Vertrieb
- Konflikte
- Nebenkosten
- HD-Produktion
- Kinder
- Kleinigkeiten
- Starthilfe
- Tiere
- Filmtrick
- Übersicht: Filmtricks
- Spezialeffekte
- Bluebox
- Animation
- Knetanimation
- Anime
- Kampfszenen
- Kaschtrick
- Modelltrick
- Projektion
- Tricktisch
- Visual Effects
- Vertigo-Effekt
- Crowd Replication
- Compositing: Plates
- Miniatur Menschen
- Zeitraffer, Timelapse, Hyperlapse
- Deepfake & Schauspieler
- Studiobau: Verkehrte Welt
- Kamera
- Übersicht: Kamera
- Objektive
- Brennweite
- Abbildungsfehler
- Lichtstärke
- Filter
- Schärfe ziehen
- Objektivsysteme
- Intelligente Objektive
- Objektivreinigung
- Alte Objektive
- Auflagemaß
- Objektive reparieren
- Bokeh
- Linsen
- Blende
- Schärfentiefe
- Normalbrennweite
- Funkschärfe
- Follow Focus
- Objektivadapter
- Objektiv-Vergütung
- Laser Entfernungsmesser
- ZEISS Supreme Prime Radiance
- Zoom-Objektive
- Cosina Sigma Tokina & Co
- Anamorphot
- Schnorchel Objektive
- Bildstabilisierung
- Kameratechnik
- Belichtung
- Stative & Schwenkköpfe
- Kamerafahrten
- Knowhow
- Kamerabühne & Grip
- 3D Aufnahmen
- Support & Zubehör
- High Definition
- Seitenverhältnis
- Kamerageschichte
- Film Analog
- Kameraleute
- Unterwasserfilme
- Virtual Reality
- Übersicht: VR, AR, XR
- VR-Sound
- VR Filme
- VR Kameras
- VR-Brillen
- VR Filme drehen
- VR Stitching
- VR Content
- VR Streitfragen
- VR Rigs
- Tech-News VR
- VR Day 2016
- VR in Bayern
- VR Verkäufe
- VR Verkaufsportal
- Google Glass revisited
- VR in Fusion
- VR Day 2017 München
- Mixed Reality
- VR-Awards
- VR Ernüchterung
- VR Geschenktipps
- 360 Grad Fotos
- Licht
- Medien
- Medienpädagogik
- Übersicht: Medienpädagogik
- Kinderfilm
- Film-Kanon
- Programmqualität
- TV-Kritik
- Teen-Movies 1
- Medienkonsum
- Second Screen
- Digitaler Schwindel
- Roter Teppich
- Facebook Ärger
- Social Media Morde
- Youtube & Kinderdaten
- Unfreiwillige Privatvideos
- Streaming Quibi
- Tödliche Selfies
- Forschungsbericht „Kinder in Filmkultur"
- Content Cleaner
- Programmplanung
- Populisten & Doku-Fakes
- Fake News & Hetze
- Medien und Pornografie
- Mehr ist Weniger
- Werbung
- Pressekodex
- Gewaltdarstellung
- Schulvorstellungen
- Castingagenturen
- Expertengipfel
- Filmpiraten
- Kriegsberichte
- Neil Postman
- Testscreening
- Telenovela
- Handy Livestream
- Opas Fernsehen
- Accessible Filmmaking
- Datenleaks
- Postproduktion
- Regie
- Übersicht: Regie
- Was uns bewegt
- Interviews
- Michel Kammoun
- Christian Petzold
- Chr. Hochhäusler
- Maja Classen
- Hendrik Handloegten
- John Hillcoat
- Francesco Rosi
- Götz Spielmann
- Elmar Fischer
- Dardenne Brüder
- Terry Gilliam
- Ralf Huettner
- Caroline Link
- Emmanuel Mouret
- Vitaly Melnikov
- Mano Khalil
- Bastian Günther
- Takuro Nakamura
- Andreas Dresen
- Cristi Puiu
- Philippe de Chauveron
- Kim Ki duk
- Davis Simanis
- Vorarbeit
- Arbeit am Set
- Gestaltung
- Regie-Geschichte
- Thesen
- Erzählhaltung
- Film & Kunst
- Freiheit
- Schauspiel
- Ton
- Künstlliche Intelligenz
- Übersicht: Künstliche Intelligenz
- KI in der Videobearbeitung
- Drehbuchschreiben mit KI
- Ängste vor der KI
- KI Alternative Mistral
- Panel: Künstliche Intelligenz
- Durst der Künstlichen Intelligenz
- Deepfake & Schauspieler
- Artificial Intelligence & Film
- KI auf der CES 2024
- Ki Film: Next Stop Paris
- KI im Dokumentarfilm
- IE9 Festival der Zukunft
- Llama 3.1 Open Source
- Animation
- Community
- Wartung & Reparatur
- Übersicht: Wartung & Reparatur
- Videoreparatur
- Verschleiss
- Computer defekt
- Stativköcher
- Tastatur-Reinigung
- Sensorreinigung
- 744T Akku reparieren
- SD 744T Upgrade
- Vorschaltgerät
- Win 7 Patchdesaster
- P2 Card Slot
- Platine reparieren
- Grafikkarte Austauschen
- Korbwindschutz Reparatur
- Objektiv Reparatur
- Halogenleuchte reparieren
- Arbeitsspeicher RAM
- Batteriefach reparieren
- Do it yourself
- Übersicht: Selber Bauen
- Akkus
- NP1-Akkubox
- Mikrofon-Kabel
- Adapter
- XLR auf Mini XLR
- Mini Klinke auf Mini XLR
- Mac Pro SSD
- Schnittrechner diy
- Threadripper Computer bauen
- Dämpfung
- Funkstrecke
- LED-Light
- Styropor Reflektor
- P2 Adapter
- Kameradolly
- Kameradolly 2
- Pin-Belegung
- Sonnenschutz
- LCD Sucher
- Lemostecker
- Power-Con Kabel
- Netzstecker montieren
- Bühnenkisten
- Kabelbinder optimieren
- DIY Nagra Netzteil
- DIY Dimmer-Handregler
- Netzteile weiternutzen
- Tipps und Tricks
- Hands On
- Knowledge Base
- Meine Presets
- Mein Projektplan
- Mein Making Of
- Ideen, Projekte & Mehr
- Filmclubs
- Wartung & Reparatur
- Seminare & Workshops
- Akademie
- Shop
- Login