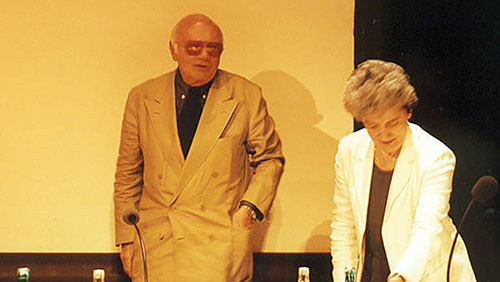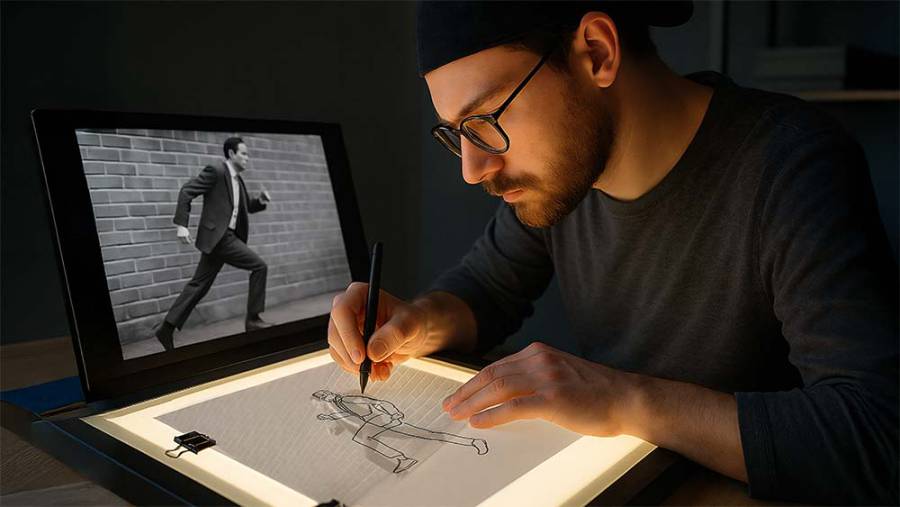Mehrere tausend Seiten Fachwissen, Fachartikel, News und mehr machen das Movie-College zu einer einmaligen Quelle von Inhalten rund um Film, Kreativität und Medien.
Menschen hören analog

Um es gleich vorweg zu nehmen, die Klänge der wirklichen Welt, die uns umgeben, sind alle analog, das heißt, sie bestehen aus kontinuierlichen Schallwellen. Und bis vor gar nicht langer Zeit haben wir diese nicht nur ebenso gehört, sondern auch analog aufgezeichnet. Inzwischen ist die analoge Tonaufnahme in vielen Bereichen von der Digitalen Aufzeichnung abgelöst worden, bei der die Schallwellen in Zahlenwerte umgesetzt werden. Da unsere Hörorgane nach wie vor analog arbeiten, erzeugen digitale Tonaufnahmen die Illusion von kontinuierlichen Schallwellen. Was bedeuten nun die rätselhaften Bezeichnungen, die einem bei der Arbeit mit Schnittprogrammen und Audiosoftware immer wieder begegnen?
Quantisierung
Bei der analog/digital Wandlung wird die Lautstärke in kurzen Abständen gemessen und aufgezeichnet. Dadurch entsteht aus der ursprünglichen Schwingungskurve, eine Kurve aus kleinen Treppenstufen. Ähnlich wie beim scannen eines Bildes, wo die Anzahl der Bildpunkte pro Flächeneinheit und die Anzahl der darstellbaren Farben (Farbtiefe) über die Qualität des Bildes entscheiden, wird der digitale Ton mit einer durch Samplingrate und Samplingtiefe vorgegebenen Auflösung punktuell abgetastet. Die beiden Parameter bestimmen wie fein/grob die Rasterung des analogen Signals ausfällt. Den Vorgang, etwas in ein vorgegebenes Raster zu übertragen nennt man Quantisierung.
Samplingrate
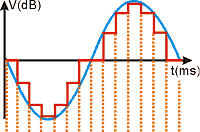
Die Anzahl der Messungen pro Sekunde wird als Samplingrate (Abtastfrequenz) bezeichnet. Um eine Schwingung überhaupt aufzeichnen zu können braucht man mindestens zwei Messpunkte pro Schwingung, so dass für die Aufnahme der höchsten wahrnehmbaren Frequenz, die bei ca. 20 kHz liegt, eine Abtastrate von mindestens 40 kHz nötig ist. So erklärt sich, dass der Standart mit dem die meisten Geräte arbeiten, bei 44100 Hz liegt. Bei einer Samplingrate von 10 kHz könnten beispielsweise nur Frequenzen bis 5000 Hz aufgenommen werden, höhere Frequenzen müssen dann durch Filter entfernt werden, da sonst Schwingungen Aufgezeichnet werden die in Wirklichkeit gar nicht vorhanden sind (Aliasing).
Natürlich steigt der Speicherbedarf und die Systemauslastung mit zunehmender Samplingrate, weshalb z.B. für Internetanwendungen gerne auf niedrigere Auflösungen zurückgegriffen wird, auch wenn die Tonqualität darunter erheblich leidet.
Samplingtiefe
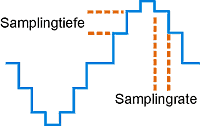
Die Samplingtiefe ist der zweite Parameter um eine Schwingung zu quantisieren: Den gemessenen Lautstärkepegeln wird jeweils ein Wert auf einer Skala zugeordnet und in Form eines Datenworts digital aufgezeichnet. Dieses Datenwort besteht aus einer festgelegten Anzahl von Binärinformationen (Bit), wobei ein Datenwort aus 8 Bit (z.B. 01001011) 256 Werte ausdrücken kann. Bei 16 Bit Quantisierung lässt sich schon eine Skala von 65536 Werten darstellen. Die Samplingtiefe gibt an, wie viel Bit für die Quantisierung der Pegelmessungen zur Verfügung stehen. Je mehr Bit, desto mehr Lautstärkenabstufungen sind möglich und desto naturgetreuer wir die Aufzeichnung ausfallen.
Speicherplatz

Der Speicherbedarf lässt sich durch Multiplikation von Samplingrate und Samplingtiefe berechnen: z.B. 44100 (1/s) x 16 Bit x 60 s (pro Minute) x 2 (bei Stereo) = 84672000 Bit = ( /8) 10584000 Byte = ( /1028) 10296 kB = ( /1028) ca. 10 MB pro Minute; bei 96 kHz / 24 Bit sind es schon ca. 33 MB pro Minute.
Speicherplatz
Gängige Formate
8 Bit / 22050 Hz – schlechte Qualität, nur noch selten, etwa im Internet, anzutreffen
16 Bit / 44100 Hz – das verbreitetste Format hat sich mit der Audio-CD durchgesetzt
16 Bit / 48000 Hz – bei DAT-Rekordern und einigen „Consumer-Geräten“ zu finden; besser als CD-Qualität
24 Bit / 48000 Hz oder 96000 Hz – derzeitiger Stand der Studiotechnik, wobei es außer der DVD & BluRay kein Medium gibt, mit dem man es abspielen könnte
Daneben gibt es noch mehr Abstufungen und Variationen, wie die 20 Bit Quantisierung oder Abtastraten von 10 kHz, 32 kHz, 64 kHz oder 82 kHz...
Kompatibilität
Mit entsprechender Software (Sample-Editoren, Samplerate-Konverter, ...) lassen sich beinahe alle Formate konvertieren, so dass die Bearbeitung im Rechner keine größeren Probleme aufwirft, selbst wenn eines der Programme ein bestimmtes Format nicht verarbeiten kann.

Anders, wenn verschiedene Geräte digital kommunizieren sollen und unterschiedliche Abtastraten verwenden. CD-Player, DAT-Rekorder oder Verstärker mit Digitalausgang, analog/digital Wandler, die Recording-Hardware des Computers oder digitale Mischpulte, alle Geräte können nur bei gleicher Sample-Rate Signale Austauschen. Im Idealfall kann die Sample-Rate am Gerät umgeschaltet werden oder sie wird automatisch erkannt und eingestellt. Wenn das nicht der Fall ist, wäre die einzige Möglichkeit ein weiteres teures Gerät anzuschaffen, das zwischengeschaltet wird und die Sample-Rate in Echtzeit umrechnet.
Geräteverbindungen sind über optische (siehe Abbildung rechts), koaxiale (Chinch, SPDIF), sowie XLR (AES/EBU) Stecker möglich. Darüber hinaus existieren für digitale Mehrspurgeräte firmeneigene Systemverbindungen etwa für ADAT oder DA88.
Digitale Töne, wie wir sie hören
Und wenn die digitalen Signale schließlich aufgenommen, bearbeitet und vielleicht auf CD, DAT, MD oder Audio DVD gespeichert worden sind, werden sie zum Hören wieder umgewandelt in (möglichst) analoge Schallwellen. Eine hohe Sample-Rate soll sicherstellen, dass unsere Ohren die vielen Stufenwerte als Illusion kontinuierlicher Wellen wahrnehmen. Ob das wirklich gelingt, darüber streiten sich bis heute die Tontechniker und Audiophilen.