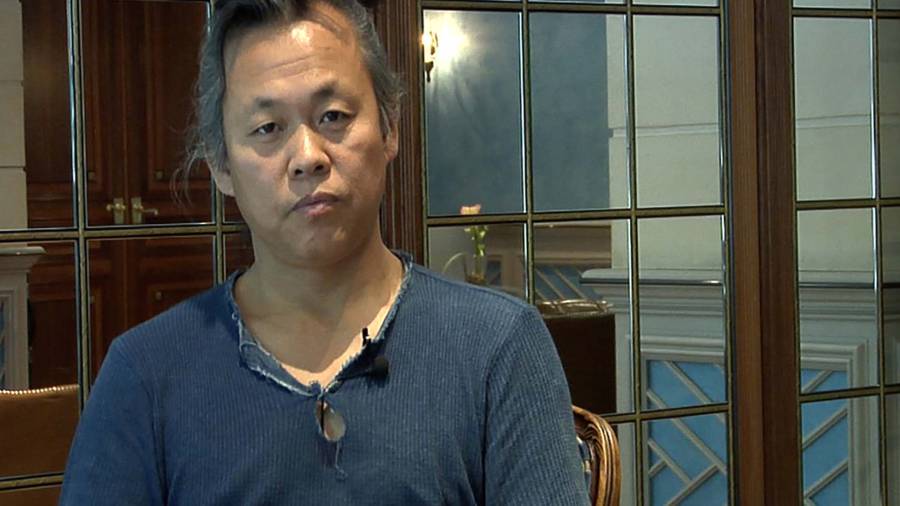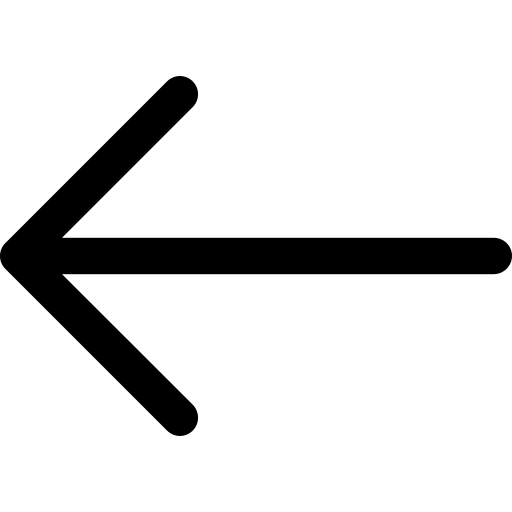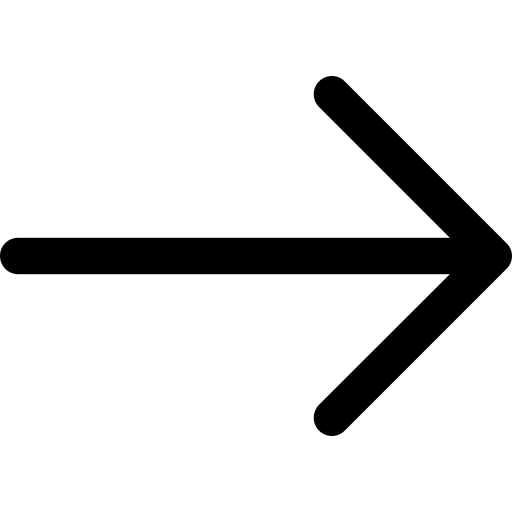Berlinale Tagebuch 2026
13 Februar 2026So ein riesiges Event ist stes sehr herausfordernd, wir berichten jenseits von Pressemitteilungen und PR von unseren Festivaleindrücken...

Vom Bootleg bis Kinox.to
12 Februar 2026Grauzonen, Schwarzkopien, Bootlegs – Wir blicken auf die Geschichte der „dunklen“ Seite des Films.

Berlinale 2026
11 Februar 2026Auf der 76. Berlinale werden über 270 Filme aus 80 Ländern zu sehen sein. Wie jedes Jahr ist auch das Movie-College wieder dabei

Blackmagic PYXIS 12K Rückruf
11 Februar 2026Einige der 12K Kameras mit Seriennummern unter 14221337 erhalten eine neue Sensorplatine kostenlos