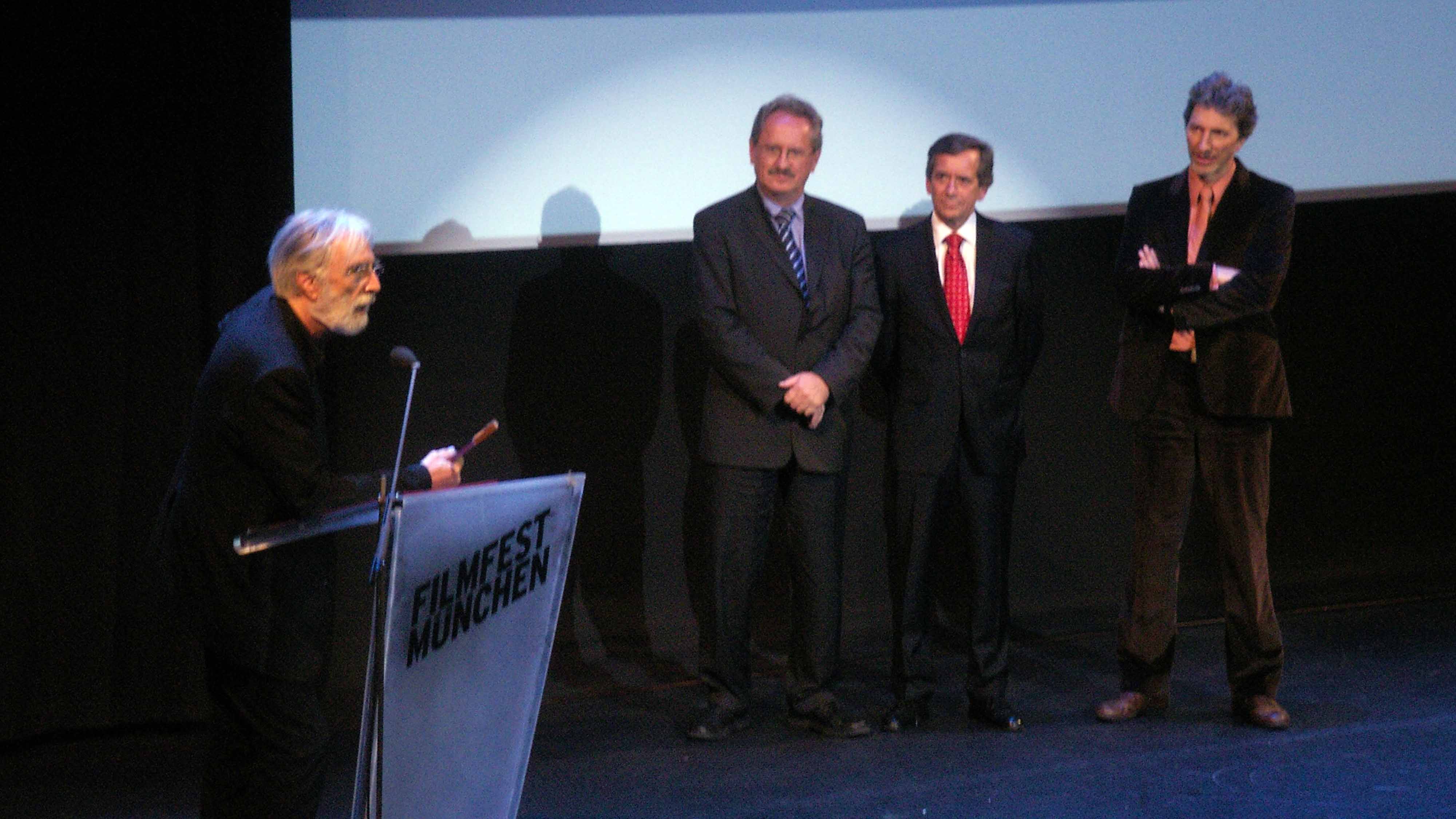Was erwartet uns beim Münchner Filmfest 2025 der zweiten Ausgabe unter Leitung von Julia Weigl und Christoph Gröner ? Das 42te Münchner Filmfest will grundsätzlich an vielen bewährten Pfeilern des Filmfests festhalten, bringt aber dennoch auch einige Neuerungen. Dazu gehört auch ein "Warm-Up" Tag vor dem eigentlichen Festivalstart und eine Eröffnungsveranstaltung mal nicht unter der Woche sondern am Samstagabend.
Das Kinderfilmfest, heißt seit letzem Jahr CineKindl, manche Dinge, die beliebt waren, aber abgeschafft wurden, sind wieder zurück, wie etwa der gedruckte Festivalkatalog oder auch der CineCoPro- Koproduktions-Preis (100.000 €). Der neue Look das neues CI, eine Isarwelle wird auch 2025l das Filmfest visuell begleiten. Auch die Preistrophäe, ein gebogenes Metall symbolisiert eine Isarwelle.
Wir stellen Euch das Programm der 42ten Ausgabe vor, berichten von Veranstaltungen und werden für Euch wieder zahlreiche Interviews mit Gästen des Festivals führen.
Seit das frühere Festivalzentrum, das Kulturzentrum Gasteig nicht mehr zur Verfügung steht und absurderweise schon jahrelang praktisch ungenutzt leerstand und nun an Firmen und Künstler untervermietet wird, ist das Amerikahaus das neue Festivalzentrum und die Isarphilharmonie ist Veranstaltungsort für die feierliche Eröffnung und mehr. Viele vermissen den Gasteig, weil er viel größer und vielfältiger war als das Amerikahaus und große Kinosäle aber auch Räume für Panels und Diskussionen bereitstellte. Neue Veranstaltungsorte wie das Deutsche Theater und das Münchner Cinema Kino sind hinzugekommen. Die Wege um von Kino zu Kino zu gelangen, sind länger geworden.

Das Programmangebot ist mit über 160 Filmen in 11 verschiedenen Reihen wieder sehr breit gefächert und viele spannende Filme warten darauf, vom 27. Juni bis 6. Juli in den Kinos entdeckt zu werden. Fast die Hälfte der Filme sind Premieren. Einige der Filme sind kurz zuvor erst in Cannes, Karlovy Vary oder auch NY Tribeca zu sehen gewesen. Wie man all das am Besten findet, zeigen wir Euch an dieser Stelle.
Hier erfahrt Ihr, wer die Preisträgerinnen im Wettbewerb "Neues Deutsches Kino" sind.
Hier findet Ihr unser Interview mit Leonard Scheicher, Hauptdarsteller im Film "Bubbles"
Hier findet Ihr unser Interview mit dem Showrunner Jeppe Gjervig Gram („Borgen“, „Follow the Money“) der eine vom Creative Europe Desk München veranstaltete Masterclass im Amerikahaus hielt.
Es lohnt sich auf jeden Fall! Über diese Buttons (nicht alle sind schon freigeschaltet) könnt Ihr die verschiedenen Filmfest München -Themenbereiche öffnen und schließen:
Das Programm FFM 25

Das Filmfest München startet am 27. Juni
Am 1. Juli starten die ersten Vorstellungen und auch dieses Jahr gibt es wieder unzählige nationale und internationale Premieren zu sehen. Bis zum 6. Juli können über 160 Filme und weitere Veranstaltungen, Gespräche und Podiumsdiskussionen besucht werden.
In den Wettbewerben CineMasters, CineVision und CineRebels werden dieses Jahr hochdotierte Preise an erfahrene Regisseure und Regieneulinge vergeben. Aber auch viele weitere Preise, wie zum Beispiel der „Förderpreis Neues Deutsches Kino“ für die besten Nachwuchsleistungen aus der gleichnamigen Reihe, der mit 70.000 Euro dotiert ist, werden dieses Jahr verliehen.
Die Filmreihen
- Wettbewerb CineMasters
- Wettbewerb CineCopro
- Wettbewerb CineVision
- Wettbewerb CineRebels
- Spotlight
- International Independents
- Förderpreis Neues deutsches Kino
- Neues Deutsche Fernsehen / Bernd Burgemeister Fernsehpreis
- Wettbewerb CineKindl
- Ehrungen
- Sonderprogramme
Wettbewerbe & Preise FFM 25
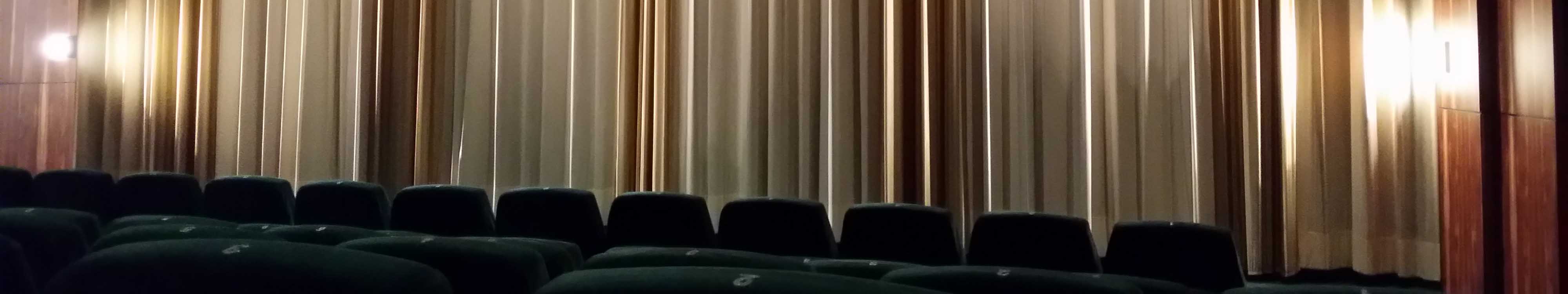
CineMasters
Dieses Jahr konkurrierten 14 internationale Filmwerke um den CineMasters Award im Wert von 15.000 Euro.
Der Preis ging an KIKA von Alexe Poukine
Jury: Emma Bading, Eva Trobisch und Maria Schrader
Folgende Filme nahmen am CineMasters Wettbewerb teil:
- AÏCHA
- HARD TRUTHS
- IN DIE SONNE SCHAUEN
- KIKA
- MAGALHÃES
- MILITANTROPOS
- NOUVELLE VAGUE
- PERLA
- PROMIS LE CIEL
- SIRÂT
- THE BALTIMORONS
- THE EXPOSURE
- WENN DER HERBST NAHT
- YES
CINECOPRO Award
ist mit 100.00 Euro die höchstdotierte Auszeichnung beim FILMFEST MÜNCHEN. Der vom FFF Bayern gestiftete Preis richtet sich an internationale Ko-Produktionen mit deutscher Beteiligung.
Der Preis ging an UN POETA von Simón Mesa Soto
Jury: Matthijs Wouter Knol, Anne Carey und Jochen Laube
CineVision
Auch für neuere Regisseur:innen blieb die Spannung hoch. Es standen 14 internationale Regietalente mit ihrem Debütfilm im Rennen um den CineVision Award im Wert von 10.000 Euro.
Der Preis geht an: AL OESTE, EN ZAPATA von David Bim
Jury: Moritz Binder, Viola Fügen und Leo Leigh
Folgende Filme nahmen am CineVision Wettbewerb teil:
- AL OESTE, EN ZAPATA
- BRIDES
- BUNNYLOVR
- CIUDAD SIN SUEÑO
- DON´T CRY, BUTTERFLY
- FENÓMENOS NATURALES
- HANI
- MY UNCLE JENS
- NUR FÜR EINEN TAG
- OUTERLANDS
- PINCH
- URCHIN
- WIND, TALK TO ME
- WINTER IN SOKCHO
CineRebels
Bereits erkennbar durch seinen Namen, wird der CineRebels Award im Wert von 15.000 EUro an die beste Regieleistung von Produktionen mit rebellischen und experimentellen Ansätzen verliehen.
Der Preis ging an: OKAMOTO von Soujiro Sanada
Jury: Anna Hints , Clemens Schick und Dascha Dauenhauer
Folgende Filme nehmen am CineRebels Wettbewerb teil:
- CYCLONE
- MISTRESS DISPELLER
- MORLAIX
- O RISO E A FACA
- OBEX
- OKAMOTO
- PAVEMENTS
- PHANTOSMIA
- SHOW ME THE PAIN OF THE WORLD
- THE VANISHING POINT
- UMA BALEIA PODE SER DILACERADA COMO UMA ESCOLA DE SAMBA
- UN GRAN CASINO
- VITTORIA
- ZAFARI
Weitere Preise
Die Gewinner*Innen des Wettbewerbs Neues Deutsches Kino findet Ihr auf einer eigenen Seite. Der CineMerit Award, der seit 1997 vergeben wird, ehrt auch dieses Jahr wieder internationale Filmschaffende für ihre Verdienste. Dieses Jahr wird dieser Award an die Schauspielerin Gillian Anderson, die im neuen Film DER SALZPFAD mitspielt, verliehen.
Workshops FFM 25
Workshops

Auch in diesem Jahr wird es wieder ein breites Angebot an Workshops und Panels geben, welches aus verschiedenen Formaten besteht.
Das Angebot will helfen, Medienkompetenz zu schulen, ein Verständnis für die Erzählsprache zu entwickeln. Filmbildung im Kino und online.
Showrunning in Europe - The Craft of Creative Leadership
Creative Europe Desk München ermöglicht eine Masterclass von Jeppe Gjervig Gram (Drehbuchautor & Showrunner Borgen, Follow the Money), die Einblicke in die Spitzenposition des Writers´ Room, in kreative Prozesse und Entscheidungsstrukturen hinter herausstechenden europäischen Serien gibt.
Di, 01.07.2025, 10.00 - 11.30
Location: Amerikahaus, Theatersaal
Sprache: Englisch
Die Teilnahme an der Masterclass ist für alle akkreditierten Gäste des FILMFESTS MÜNCHEN möglich.
Infos zu dem Workshop findet Ihr auch unter dem Button "Veranstaltungen". Unser Interview mit Jeppe Gjervig Gram findet Ihr.
Leadership mit Haltung - Achtsam führen in der Filmproduktion
Fair Play Film+Kultur lädt zu einem Workshop im Amerikahaus ein. Achtsamkeit in der Führung ist der Schlüssel zu Kreativität, Motivation und gutes Teamwork. Doch wie funktioniert das im Produktionsalltag? Christine von Fragstein (FAIR PLAY Leadership in Film + Kultur) und Jana Kreissl (Resilienztrainierin) geben Impulse zu Führung und Selbstführung.
Do, 03.07.25, 12:30 – 13:45 Uhr
Location: Amerikahaus, Karolinensaal
Sprache: Deutsch
Für alle Akkreditierte des FILMFEST MÜNCHEN offen.
Kritiken FFM 25
"Bubbles" (Regie: Sebastian Husak)

Regie: Sebastian Husak
Kamera: Nikolai Huber
Buch: Leonard Hettich und Sebastian Husak
Produzent:in: Andreas Schmidbauer, Tanja Schmidbauer
Weltpremiere, Filmfest München 2025 – in der Sektion Neues Deutsches Kino
Fiete und seine Freundin Amiri verbringen ein Wochenende am Wattenmeer – doch dieses wird zu einer emotionalen Zerreißprobe, als sie auf Fietes ehemaligen besten Freund Luca treffen. Dieser lebt mittlerweile in einer völlig anderen „Bubble“ und konfrontiert Fiete mit seiner Vergangenheit, die dieser lieber verdrängt hätte. Im Zentrum steht eine ungeklärte Schuldfrage, die mit einer zurückliegenden Katastrophe verknüpft ist. Als die drei unter Druck geraten und die gespaltenen Lebenswelten aufeinanderprallen, eskaliert die Situation. Die Lage gerät außer Kontrolle …
Das 85-minütige Drama „Bubbles“, das unter der Regie von Sebastian Husak realisiert wurde, erzählt die Geschichte einer ehemals engen Freundschaft und eines gemeinsamen Schicksals, das bis in die Gegenwart hinein verschwiegen bleibt. Im Mittelpunkt steht ein Beziehungsdreieck zwischen Fiete (Leonard Scheicher), Amiri (Zeynep Bozbay) und Luca (Johannes Nussbaum) – brüchig, komplex und tief verstrickt. Im Verlauf der Erzählung wird Fietes und Lucas gemeinsame Vergangenheit zunehmend enthüllt – und mit ihr auch die Tragödie aus der Jugendzeit. Auch die Unterschiede zwischen den Charakteren werden immer deutlicher. Amiri verkörpert in Lucas Augen eine „heile Welt“, während er sich politisch immer weiter in die rechte Richtung radikalisiert. Fiete erkennt in Luca kaum noch den Menschen wieder, der einst sein bester Freund war. Im inneren Konflikt zwischen der Loyalität zu seinem früheren Ich und seiner neuen Realität mit Amiri wirkt Fiete zerrissen. Und schnell wird klar: Fiete ist nicht immer ehrlich. Er neigt dazu, „Unangenehmes“ aus dem Weg zu gehen – mit weitreichenden Folgen.
Schmidbauer-Film,%20Nikolai%20Huber_%20Das%20Dreiergespann%20aus%20Bubbles%20-%20Fiete%20(Leonard%20Scheicher,%20l),%20Johannes%20Nussbaum%20(m)%20und%20Amiri%20(Zeynep%20Bozbay,%20r)-4000.jpg)
Durch die steigernd emotionalen und hitzigen Situationen schafft es der Film, eine eindringliche Spannungskurve mit pointiertem Höhepunkt zu kreieren. Insbesondere die scheinbar ausgelassenen und harmlosen Momente, die von einem Augenblick in den nächsten eine ernsthafte Bedrohlichkeit annehmen, sorgen für fassungslose und gespannte Gesichter im Zuschauersaal. Hinzu kommen düstere Stilelemente wie eine kühle Farbgebung, schlammige Schauplätze und zahlreiche Nachtszenen, die die Beklemmung im Film zusätzlich verstärken.
Doch der Film bleibt nicht nur wegen seiner dichten Atmosphäre im Gedächtnis. Auch das teils offene Ende bewegt – und eröffnet einen weiten Interpretationsspielraum. Das Ende mag auf manche Kinobesucher:innen ernüchternd wirken, insbesondere auf jene, die auf einen eindeutigen und harmonischen Ausgang gehofft hatten. Die Botschaft aber bleibt: Wie gehen wir mit verschiedenen „Bubbles“ um? Eine Thematik, die besonders in Zeiten wie diesen als eine sehr wichtige erscheint. Hätte Lucas starke politische Entfremdung von seinem früheren Ich verhindert werden können? Ist Fietes vermeidende, unehrliche Art letztlich die gefährlichere? Auch seine Persönlichkeit sorgt nämlich für viel Konfliktpotenzial. Er geht so scheinbar den „leichten“ Weg, doch welche Konsequenzen hat das für ihn und für seine Mitmenschen? Ist Schweigen und Verdrängung besser, als sich der schmerzhaften Wahrheit zu stellen? Zumindest für Fiete wird sein Netz aus Lügen schließlich zum Verhängnis – und entpuppt sich als großes Chaos.
Der Film wirkt auf mehreren Ebenen - und überzeugt besonders durch seine Authentizität und seinen bissigen Humor – scharf, ironisch, stellenweise provokant und verletzend. Genau damit hebt sich der Film von anderen Dramen ab. Mit seiner gesellschaftlichen Relevanz, der faszinierenden Dialogstärke und der schaurigen Bildsprache ist daher ein Kinobesuch in dem Drama „Bubbles“ wärmstens zu empfehlen.
Filmkritik von Meike Olpp
Unser Interview mit einem der Hauptdarsteller Leonard Scheicher
"In die Sonne schauen" (Regie: Mascha Schilinski)

Regie: Mascha Schilinski
Kamera: Fabian Gamper
Produktion: Lucas Schmidt, Lasse Scharpen, Maren Schmitt
Deutsche Premiere, Filmfest München 2025 - Gewinner des Preises der Jury auf den Internationalen Filmfestspielen von Cannes 2025
Der deutsche Spielfilm „In die Sonne schauen“ von Regisseurin Mascha Schilinski erzählt die Geschichte vierer Frauen, die über eine Zeitspanne von 100 Jahren auf demselben Bauernhofgelände in der Altmark gelebt haben. Im Rahmen eines assoziativen Stroms aus Erinnerungen, die prägende Ereignisse und Wahrnehmungen der Mädchen und Frauen aufgreifen, fügen sich scheinbar lose Fragmente zu einem Großen und Ganzen zusammen. Das Drama folgt seiner eigenen inneren Logik, spielt mit Erwartungen und Ängsten des Publikums und bedient sich einer filmischen Sprache, die bis zum Abspann in Atem hält.
Die Leben der vier Protagonistinnen sind intrinsisch miteinander verbunden. Die siebenjährige Alma wächst zur Vorkriegszeit im Deutschen Kaiserreich auf, in einer streng religiösen Familie, die in ihr schon früh morbide Vorstellungen über das Sterben hervorruft. Als sie eines Tages eine erstaunliche Ähnlichkeit zu ihrer verstorbenen Schwester auf einer Fotografie erkennt, wächst in ihr die Überzeugung, für das gleiche Schicksal bestimmt zu sein. Erika wohnt zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs auf dem Gutshof und entwickelt eine ungesunde Obsession zu ihrem kriegsversehrten, bettlägerigen Onkel, die sie nicht nur dazu treibt, ihre Arbeit auf dem Hof zu vernachlässigen, sondern auch selbst eine Amputation zu simulieren. Angelika lebt zu Zeiten der DDR auf dem Bauernhof und befindet sich in einer ständigen Spirale aus Lebenslust und Todeswunsch, ausgelöst durch den Missbrauch ihres Onkels und das wachsende Interesse ihres Cousins. In der Gegenwart wird der Hof von der Berlinerin Nelly und ihrer Familie bewohnt, die das Grundstück trotz seiner Altlasten wieder renovieren möchte. Im Laufe dieses Unterfangens wird sie allerdings selbst von belastenden Träumen aus der Vergangenheit heimgesucht. Der Kreis schließt sich, als sich ein tragisches Ereignis aus der Geschichte des Hofs wiederholt.
„In die Sonne schauen“ hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Das Zusammenspiel der melancholischen, bisweilen düster-eindringlichen Filmmusik, der bildgewaltigen Erzählweise und der komplexen, teils belastenden Kernmaterie der Geschichte – die konstante Auseinandersetzung mit Leben, Tod und Sterben – sorgt auch nach dem Verlassen des Kinosaals für eine nachhaltige Auseinandersetzung mit den Emotionen, die der Spielfilm seinem Publikum entlockt.
Während deutsche Kandidaten auf dem Wettbewerb der Filmfestspiele in Cannes ein äußerst seltener Anblick sind, ist es unserer Einschätzung nach keine Überraschung, dass sich Mascha Schilinskis metaphorischer Liebesbrief an das experimentelle Filmemachen, an das Martyrium des Frauseins in einem historischen wie auch gegenwärtigen Kontext – Ja, sogar an das Leben selbst – als eines dieser wertvollen Unikate entpuppt hat.
Filmkritik von Sophia Schönberger
"Der Salzpfad" (Regie: Marianne Elliott)
An Evening with Gillian Anderson – Eindrücke einer besonderen Premiere

Im Innenhof des Deutschen Theaters drängen sich eifrige Journalist*innen an begeisterte Fans, als der internationale Ehrengast und die Preisträgerin des diesjährigen CineMerit-Awards des Münchner Filmfests, die amerikanische Schauspielerin Gillian Anderson, am Vorabend der Deutschland-Premiere ihres neuen Films „Der Salzpfad“ über den blauen Teppich schreitet.
Bekannt für ihre ikonischen Rollen als FBI-Agentin Dana Scully in „Akte X“, der historischen Margaret Thatcher in „The Crown“ oder als Hannibal Lecters Psychiaterin Bedelia du Maurier in NBCs „Hannibal“, wird der geradezu überwältigten Schauspielerin post Laudatio auf ihre Karriere die CineMerit-Auszeichnung vor dem Münchner Publikum verliehen. Eine Würdigung sowohl ihrer herausragenden Verdienste um die Filmkunst, als auch ihres langjährigen Engagements für den Feminismus und soziale Gerechtigkeit.
Im Anschluss an die Premiere von Gillian Andersons Spielfilm “Der Salzpfad” rundet den Abend im Deutschen Theater ein Bühnengespräch mit BR-Moderatorin Christina Wolf ab. Obgleich die Schauspielerin sich bei Fragen zu dem Entstehungsprozess des Films, ihrer persönlichen Schauspielphilosophie oder ihrem sozialen Engagement hin und wieder sammeln muss, trägt das enthusiastische Publikum sie mit Jubel und Zuspruch über etwaige Verschnaufpausen hinweg.
Sobald das Münchner Filmfest Anderson den obligatorischen Blumenstrauß überreicht hat, eilt sie von der Bühne, bietet der Presse und
ihren Fans aber noch eine weitere Gelegenheit für Schnappschüsse und einen persönlicheren Abschied draußen auf dem Blauen Teppich.
Filmkritik - “Der Salzpfad”

Regie: Marianne Elliott
Kamera: Hélène Louvart
Produktion: Elizabeth Karlsen, Stephen Woolley
Vereinigtes Königreich, 2024 - Deutsche Premiere beim Münchner Filmfest 2025
Basierend auf dem autobiografischen Reisetagebuch der Britin Raynor Winn, begleitet das emotionale Drama “Der Salzpfad” das britische Ehepaar Raynor und Moth auf ihrer beschwerlichen, aber sinnstiftenden Wanderung entlang der englischen Südwestküste.
Nachdem sie aus einer finanziellen Notlage heraus nicht nur ihre letzten Ersparnisse und Jobs, sondern auch ihr geliebtes Farmhaus aufgeben müssen, entscheiden Raynor und Moth sich dazu, “einfach loszulaufen” bis ihnen ein sprichwörtliches Licht aufgeht.
“Der Salzpfad” veranschaulicht auf berührend menschliche und zugleich schockierend ehrliche Weise, was es wirklich heißt, am Leben zu sein. Wer und was tatsächlich zählt, wenn man am absoluten Tiefpunkt angekommen ist.
Denn entlang der 1000 Kilometer langen Wanderung belastet das Paar sowohl Moths unheilbare Nervenkrankheit als auch die Charakterschwäche einiger Menschen, die ihnen unterwegs begegnen.
Aller Widrigkeiten zum Trotz erreichen die Beiden schließlich das Ziel ihrer Reise - gestärkt als Eheleute und als Menschen – und wagen einen Neuanfang, der auch dem Publikum Zuversicht für die eigene Zukunft schenkt.
Gillian Anderson und Jason Isaacs (“Moth Winn”) überzeugen auf ganzer Linie. Verletzlich, grenzüberschreitend und aufrichtig – so lässt sich die Leistung der beiden Hauptdarsteller zusammenfassen.
Inmitten von wilder Naturromantik, Kapitalismuskritik und einem filmischen Aufruf zur Selbstreflexion, gelingt dem britischen Drama “Der Salzpfad” eine eindrückliche Adaption des Bestsellers, der ihm zugrunde liegt.
Filmkritik von Sophia Schönberger
"Friedas Fall" (Regie: Maria Brendle)

Regie: Maria Brendle
Produzent:in/: Hans Syz, Susann Henggeler
Produktion (Firma): Condor Films AG, Swiss Television SRF
Nominiert in der Reihe Spotlight auf dem Filmfest München 2025
Friedas Fall erzählt die bewegende Geschichte der 25-jährigen Schneiderin Frieda Keller aus St. Gallen, die im Jahr 1904 den Mord an ihrem eigenen Sohn gesteht. Die Leiche des kleinen Kindes wird in einem Waldstück gefunden – eine erschütternde Tat, die auf einer wahren Begebenheit beruht. Doch wie konnte es so weit kommen? Was treibt eine Mutter zu so einer grausamen Handlung? In einem aufsehenerregenden Gerichtsprozess wird nach Antworten gesucht – mit besonderem Blick auf die Situation der Frauen innerhalb patriarchaler Strukturen. Der Fall entwickelt sich zu einem Justizskandal: Staatsanwaltschaft und Verteidigung geraten in einen emotionalen Kampf zwischen Recht und Gerechtigkeit – mit tiefgreifenden Folgen. Der historische Fall Frieda Keller prägte die Anfänge der politischen Gleichstellung und der Schweizer Frauenrechtsbewegung. Das aufrüttelnde Drama legt schonungslos die Realitäten von Frauen offen und wirft prägnante Fragen auf – nicht zuletzt durch die Figuren selbst.
Im Zentrum steht Frieda (gespielt von Julia Buchmann), die von ihrer Heimat gefürchtet und verurteilt wird – und dennoch über weite Strecken hinweg eine bemerkenswerte Ruhe und Fassung bewahrt. Diese mentale Zurückhaltung verleiht ihrer Figur eine geheimnisvolle Aura, die sich wie ein dichter Schleier über die Handlung legt – spürbar auch im Kinosaal, wo das Publikum in fassungslose Stille verfällt.
Neben Frieda sticht eine weitere weibliche Figur hervor: Erna Gmür, die Ehefrau des Staatsanwalts. Sie hat keine Angst vor Frieda - im Gegenteil, sie besucht Frieda immer wieder im Gefängnis. Mit Empathie, Ehrlichkeit und feinem moralischen Gespür nähert sie sich Frieda auf menschlicher Ebene an. Sie sieht in ihr mehr als nur eine Mörderin. Erna wird damit zur stillen Heldin des Films – eine Verkörperung weiblicher Stärke und Courage.
Auffällig ist der eingesetzte schweizerdeutsche Dialekt, den die meisten Protagonisten im Film sprechen und der zur Authentizität beiträgt. Dieser kann für manche Kinobesucher:innen jedoch eine sprachliche Hürde darstellen. Der englische Untertitel bietet hierfür allerdings eine gelungene Alternative.
Der Höhepunkt ist der Gerichtsprozess im Gerichtssaal: In langen Plädoyers stehen sich der attraktive Verteidiger Arnold Janggen (gespielt von Max Simonischek) und der eher mürrische Staatsanwalt Walter Gmür (gespielt von Stefan Merki) gegenüber. Hier kommt die schauspielerische Stärke beider besonders zum Vorschein. Der Prozess wird zum emotionalen Kraftakt - nicht nur für Frieda, sondern auch für das Kinopublikum. Er geht unter die Haut und rührt manche Zuschauer:innen sogar zu Tränen.
Friedas Fall ist ein spektakulärer Film, der lange nachhallt. Die intensive Gefühlswelt, die er entfaltet, macht betroffen. Aber im positiven Sinne, denn der Film regt dazu an, die Geschichte, die oft hinter dem Menschen verborgen bleibt, zu erforschen, statt vorschnell zu urteilen. Diese Botschaft vereint das historische Drama gemeinsam mit wichtigen Fragen rund um Schuld und Scham – Gefühle, die oft „unter den Teppich gekehrt und verdrängt werden“. Verletzlichkeit, Veränderung und Mut spielen ebenso eine große Rolle. Der Film ruft eindrücklich dazu auf, eigene Denkmuster zu hinterfragen. Ein sehenswerter Impuls zur Aufarbeitung weiblicher Lebensrealitäten – und ein kraftvoller Appell, gesellschaftliche Fesseln zu lösen.
Filmkritik von Meike Olpp
Events FFM 25
Die Liste der Veranstaltungen beim Internationalen Münchner Filmfest ist lang, man kann eigentlich nur eine kleine Auswahl wahrnehmen, deshalb ist unser kleiner Überblick wie immer nur ein winziger Ausschnitt. Auf der Seite des Filmfests findet Ihr eine Übersicht unter "Events & Talks".
Eröffnungsveranstaltung

Das diesjährige Filmfestival wurde nun zum vierten Mal in der Isarphilharmonie, der neuen inzwischen gut angenommenen Konzerthalle der Stadt München, diesmal mit dem Film „The Ballad of Wallis Island” eröffnet. Die Story des Films spielt Wallis Island, wo der Musiker Herb McGwyer für ein Konzert anreist und erlebt dass ein Konzert nur von einem einzigen Besucher, Charles einem enthusiastischen Fan besucht wird. Und dann taucht auch noch seine ehemalige Partnerin auf....

Das Wetter war heiß, aber nicht gewittrig also perfekt und die Stadt ahnte noch nicht, wieviel heißere Tage noch folgen werden. Die Filmgemeinde kam, die Isarphilharmonie war gut besucht und das Event ein willkommenes Wiedersehen mit Kolleg*Innen aus der Filmbranche und ein gelungener sommerlicher Auftakt für das größte Deutsche Publikumsfilmfestival.

Auf dem roten Teppich, der in München beim Opening überraschend Türkisfarben ist, zeigten sich zahlreiche Akteure des Kinos, Schauspieler*Innen, Regisseur*Innen, aber auch Politiker*Innen und viele andere mehr oder weniger Prominente.
Mehrheitlich waren es Schauspieler*Innen, viele eher dem Fernsehen als dem Kino zuzuordnen, die das Blitzlichtgewitter sichtlich genossen. Es gab auch internationale Gäste wie Tom Basden, Tim Key sowie Regisseur James Griffiths. Die Schlange der Promis vor dem türkisfarbenen Teppich war so lang und das Ensemble von "The Ballad of Ellys Island" so spät erst auf dem türkisen Teppich, dass die Eröffnungsveranstaltung mit deutlicher Verspätung begann.
Rund um das Festival gibt es eine Reihe von Veranstaltungen, über einige davon werden wir an dieser Stelle berichten...

Montag, 30. Juni
Die Aufführung von "American Sweatshop" in der Arri Astor Film Lounge war ein Highlight der besonderen Art. Im Mittelpunkt des Films steht die junge Daisy die als "Cleanerin" für ein Soziales Netzwerk Hunderte anstößige Beiträge täglich überprüfen muss. Daisy ist zwar ziemlich abgestumpft, doch ein besonders brutales Video lässt sie nicht los. Deshalb gibt sie die Sicherheit und Distanz ihres Schreibtischs auf, um in der realen Welt für Gerechtigkeit zu sorgen. Der Film den die Deutsche Regisseurin und Kamerafrau Uta Briesewitz als Deutsch-Amerikanische Koproduktion mit Elsani Film und Baltimore Pictures realisiert hat, spielt irgendwo im Süden der USA. Was die Zuschauer allerdings nicht ahnen,- er wurde gänzlich in Köln gedreht und sieht aber wie ein amerikanischer Kinofilm aus. Für dieses Kunststück haben neben dem hervorragenden Cast (Lili Reinhart, Daniela Melchior, Jeremy Ang Jones, Josh Whitehouse, Christiane Paul, Tim Plester, Joel Fry) auf der visuellen Seite DOP Jörg Widmer, Produktionsdesignerin Jutta Freyer, Kostümbildnerin Nadine Waeldchen und auf der Tonebene Frederik Thomsen gesorgt. Der Film zeigt auf beeindruckende Weise, was all der digitale Müll unserer Zeit mit Menschen, die das ansehen und absortieren müssen, anrichtet. Ein starker Film.


Dienstag 1. Juli
Die Masterclass Showrunning in Europe: The Craft of Creative Leadership von Jeppe Gjervig Gram („Borgen“, „Follow the Money“) wurde vom Creative Europe Desk München organisisert und angeboten. In der gut besuchten Veranstaltung im Theatersaal des Amerika-Hauses erklärte der mehrfach ausgezeichnete Dänische Drehbuchautor und Showrunner Arbeitsmethoden und Herausforderungen von den "Writers Rooms" in denen der tätig ist, bzw. die er leitet. Im Anschluss an die Veranstaltung hatten wir Gelegenheit zu einem Interview mit Jeppe Gjervig Gram, welches wir ebenfalls hier im Movie-College veröffentlichen. Eine rundum gelungene Veranstaltung nicht nur für Drehbuch-Profis und alle, die es werden wollen.
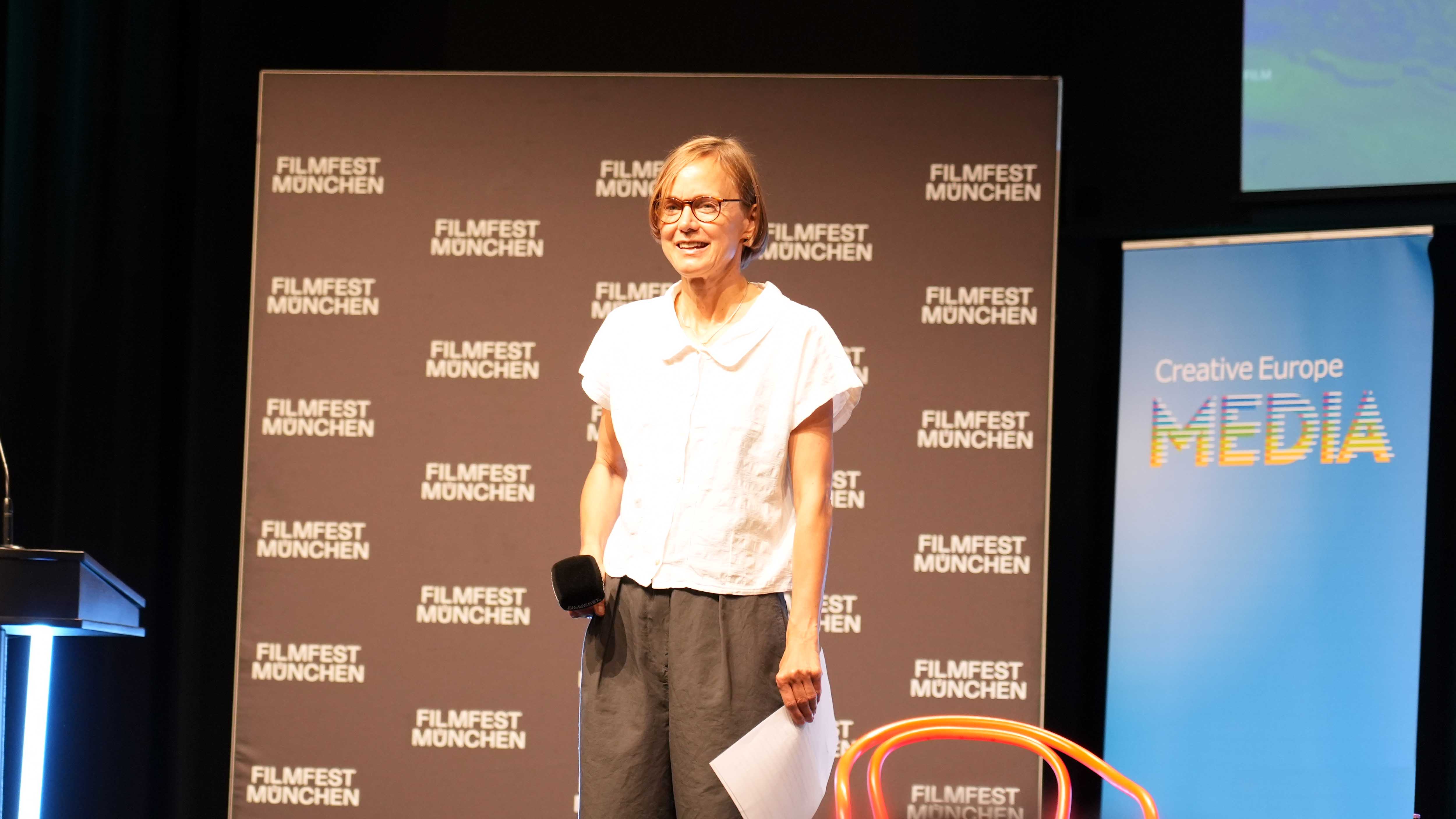

Mittwoch 2. Juli

FFF XR Meet & Mingle - Eigentlich eine Veranstaltung, die mit der parallel stattfindenden XR Messe "MUNICH BEYOND: XR Exhibition, Panels" im Kongresszentrum des Deutschen Museums zusammenhängt, aber neuerdings auch irgendwie mit dem Filmfest kooperiert. Warum nicht? Auf der Terrasse des Rustikeria – Bottega Toscana im Müllerschen Volksbad traf sich die VR und XR Szene zum Gedankenaustausch im Schatten alter Bäume und Sonnenschirme. Konstant auf der Suche, die Erfahrungen mit VR und XR Brillen massentauglicher zu machen und natürlich auch weitere Budgets dafür zu bekommen, finden die Kreativen und Produzenten der entsprechenden Inhalte beim FFF Bayern kompetente Ansprechpartner. Hier ist vor allem Max Permantier, der Förderreferent für Extended Realities (XR) und Virtual Reality (VR) zu nennen, der kontinuierlich mit der bayerischen Kreativszene in Kontakt ist und diese auch unermüdlich miteinander vernetzt.

Beergarden
Im Garten des Amerikahauses gibt es einen offenen und einen für Akkreditierte oder für Eingeladene Gäste von Veranstaltungen reservierten Biergarten Bereich in dem es sich hervorragend verweilen, connecten und diskutieren lässt.

40 Jahre FFM
40 Jahre Filmfest sind schon eine kleine Ewigkeit...
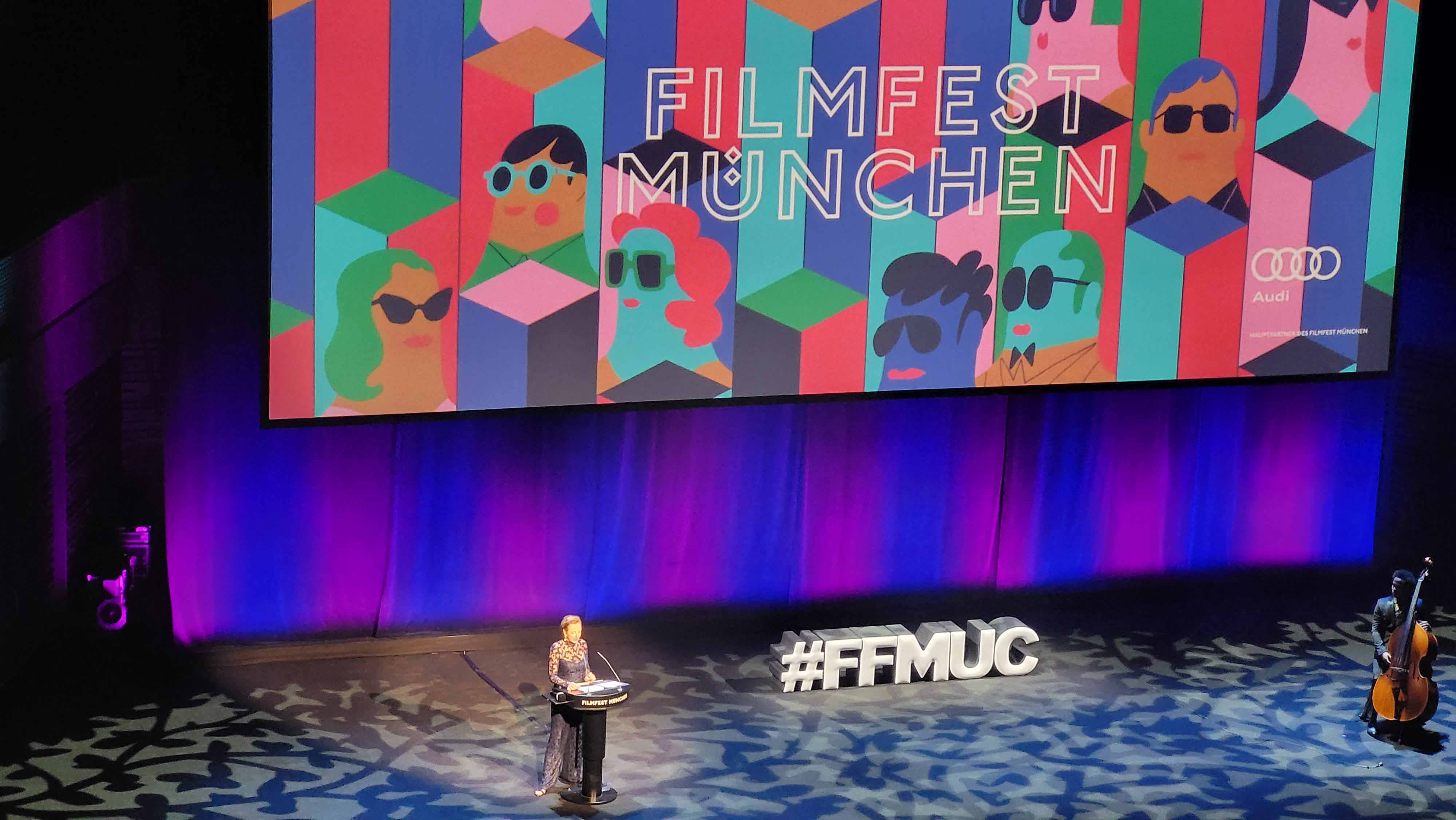
Geschichtliches
40 Jahre Filmfest München, das fühlte sich im Jahr 2023 nach einer kleinen Ewigkeit an. Dabei war der Start durchaus holprig und von Streitigkeiten, Intrigen und einem handfesten Skandal begleitet. Die Idee eines eigenen Filmfestivals in der heimlichen Filmhauptstadt München geisterte in vielen Köpfen herum. Bereits 1977 gab es ein erstes "Münchner Filmtreffen" im ARRI-Kino in der Türkenstraße. Man zeigte Filme des jungen Deutschen Films, ein Begriff der aus der Oberhausener Generation stammte und dachte über eine Fortsetzung und Erweiterung nach.
München wollte schon immer leuchten und das galt auch und insbesondere in Zusammenhang mit Film und Kino. Bereits Ende der Siebziger Jahre gab es kulturpolitische Bestrebungen, in München ein Festival zu etablieren, was vom äußeren Anschein mit Cannes oder Berlin mithalten sollte. Glamour und Größe gehörten zu den Attributen auf dem Wunschzettel, der von Politik und Tourismusinteressen geprägt war.
Zur Umsetzung dieses großen Vorhabens gründete man 1979 die "Münchner Filmwochen GmbH". Gesellschafter wurden die üblichen "Verdächtigen", die Landeshauptstadt München, der Freistaat Bayern, der Bayerische Rundfunk und die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (SPIO). Diese verschiedenen Gesellschafter verfolgten höchst unterschiedliche Absichten, was ein solches Festival sein solle, es wurde viel diskutiert und gestritten.
Oberbürgermeister Erich Kiesel machte Alfred Wurm, einen Organisator von Modemessen zum Geschäftsführer. Zur Finanzierung der ganzen Veranstaltung entzog man einfach, ohne mit den Betroffenen zu sprechen, den bisher von der Stadt geförderten verschiedenen Filmgruppen die durch das Münchner Kulturreferat vergebenen Budgets und steckte sie kurzerhand in die Filmwochen GmbH. Dazu muss man wissen, dass es damals wie heute in München zahlreiche Vereine und Gruppierungen gab und gibt, welche die Filmkultur in vielen Facetten pflegen.
Das rigorose Vorgehen führte natürlich zu massiven Protesten der betroffenen Münchner Filmgruppen, doch sie wurden gänzlich ignoriert. Oberbürgermeister Kiesl organisierte für den 25. Januar 1979 eine aufwändige Veranstaltung, für die eigens Geraldine Chaplin eingeflogen wurde und präsentierte Alfred Wurm als Geschäftsführer der "Münchner Filmwochen GmbH", wie das Unternehmen übrigens noch heute heißt, allerdings unter anderen Vorzeichen.
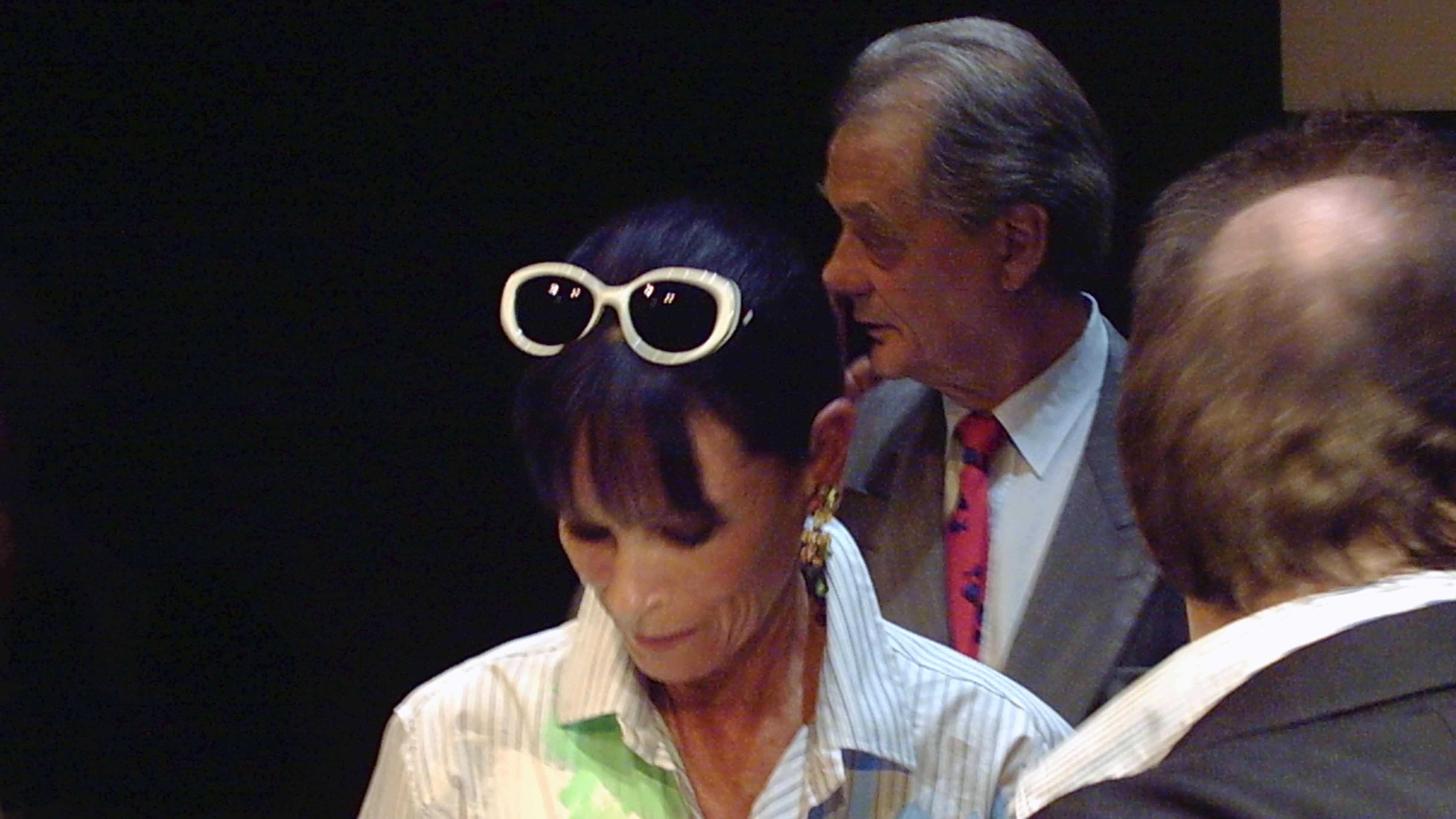
Aus Protest gegen Kiesels Pläne fuhren Filmemacher wie Schlöndorff, Herzog, Kluge, Fassbinder und viele Andere im Mai 1979 nach Hamburg, um dort das „Filmfest der Filmemacher“ zu feiern. Vor allem der deutsche Film stand im Mittelpunkt und das Filmfest sollte so weit wie möglich von roten teppichen und Glamour entfernt sein. Im Folgejahr zog das Filmfest der Filmemacher weiter nach Düsseldorf.
Kiesel, Wurm und eine größere Entourage, zu der auch AZ Kolumnist Michael Graeter gehörte, genehmigten sich mit einem Budget von einer halben Million DM "Informationsreisen" nach Cannes und in die USA. Als die Machenschaften rund um die Festivalgründung bekannt wurden, befanden sich Alfred Wurm und Oberbürgermeister Erich Kiesl verdientermaßen mitten in einem politischen Skandal. Vorwürfe und Intrigen rund um die frühe Filmwochen GmbH wären gewiss einen eigenen Film wert gewesen. Man warf ihnen grobe Verschwendung von Steuergeldern zur angeblichen Vorbereitung des Münchner Filmfestes vor. 1980 trat Wurm von seinem Posten zurück und der Weg für einen gänzlich anderen Ansatz wurde frei.
Man bemühte sich, die Filmemacher einzubinden und 1983 fand erstmals tatsächlich ein Münchner Filmfest unter der Leitung von Eberhard Hauff, selbst Regisseur und Bruder des Regisseurs Reinhard Hauff statt. Er leitete das Festival daraufhin bis 2003. Das war ein Balanceakt, weil Hauff einerseits den zumeist links orientierten Deutschen Filmemacher*Innen einen Gegenentwurf zu den Glamourplänen von Kiesel & Co präsentieren musste, andererseits aber genau diese Hoffnungen von Seiten der Stadt und des Freistaates bedienen musste.
In diesem ersten Jahr war das Festivalzentrum im Künstlerhaus am Lenbachplatz angesiedelt. Doch bereits 1985 zog man um in das neue Kulturzentrum der Stadt, den Gasteig an der Rosenheimer Straße, welches bis 2019 Festivalzentrum geblieben ist. Die Deutsche Reihe wurde viele Jahre kuratiert von Ulrich Maass, die Reihe "American Indies betreute Ulla Rapp und das internationale Programm, sowie lateinamerikanische, asiatische und osteuropäische Filme von Klaus Eder, Robert Fischer und Uschi Reich.

2004 übernahm dann Andreas Ströhl, der eigentlich vom Goethe Institut kam, die Festivalleitung, bis 2011 als dann Diana Iljine die Leitung übernahm. Wie schon von Beginn an waren die Entscheidungen, wer die Leitung des Filmfest übernehmen wird, stets von den verschiedenen Interessensgruppen und der Münchner und der Bayerischen Politik mitgeprägt. Die genaue Ausrichtung des Festivals wurde regelmäßig diskutiert und pendelte stets irgendwo zwischen der Idee, den Münchnern tolle Filme präsentieren zu können und dem Vorhaben, die bayerische Landeshauptstadt mit glamourösem Starzauber zu überziehen und den Filmstandort maximal zu bewerben.

Eigene Erinnerungen
Als Autor dieses Artikels (Prof. Mathias Allary) waren meine eigenen Begegnungen mit dem Münchner Filmfest durchwegs erfreulich und inspirierend. Bereits 1986, ein Jahr nach meinem Abschluss an der HFF München, zeigte ich in der "Deutschen Reihe" meinen Kurzfilm "Keinerlei Besorgnis", einen der wenigen deutschen Spielfilme zum Reaktorunglück in Tschernobyl und 1989 dann meinen ersten abendfüllenden Spielfilm "Franta" mit Nicole Ansari, Jan Kurbjuweit und Ben Hecker in den Hauptrollen.
Ich erinnere mich noch sehr genau an die Premiere des Films im Münchner Rio Palast am Rosenheimer Platz. Schauspieler*Innen, Teammmitglieder, die Redakteurin Susan Schulte (SWF), wir alle saßen im großen Saal des Rio, verteilt auf den ganzen Saal. Ich saß ganz vorne, lauschte auf jede Reaktion und hatte 89 MInuten lang Herzklopfen vor Aufregung. Dann war der Film zu Ende, die Lichter gingen an im Saal und es herrschte eine gefühlte Ewigkeit lang Stille. Ich dachte, der Film sei durchgefallen, wir am Film Beteiligten, schauten uns ängstlich an. Doch dann plötzlich setzte ein tosender Applaus ein, der nicht mehr enden wollte. Das Filmfest selbst wusste offensichtlich gar nicht, was für eine Zufallsentdeckung es da gemacht hatte. So schrieb etwa der Filmkritiker Wolfgang Brenner: "Daß es nach Fassbinder dieses Kino nicht mehr gegeben hat, ist schlimm genug, es muß nicht auch noch der Skandal hinzukommen, daß es bei seinem zufälligen Aufflackern übersehen wird. Wenn sich das Filmfest München doch gelohnt hat – dann vor allem wegen diesem Film". Damals besuchten noch viele Programmer anderer Festivals das Münchner Filmfest (heute ist das anders) und so begann "Franta" eine jahrelange erfolgreiche Reise zu den großen Filmfestivals in der Welt, darunter Toronto, Montreal, Edinburg, Cork, São Paulo u.v.a.
In den Folgejahren war das Filmfest stets der ideale Ort für Begegnungen mit Kolleg*Innen aus der Filmbranche, Ort um neue Projekte anzustoßen und einfach auch ein Stückweit Familientreffen. Das hat sich bis heute nicht geändert.

Seit 1999 begleitet das Movie-College das Münchner Filmfest, anfänglich in Wort und Bild, seit 2002 auch mit Videointerviews. Viele Jahre lang war das Movie-College Medienpartner des Filmfests und hat unter anderem die Reihe "A Film by" (Kurzsstatements der beteiligten Regisseur*Innen) auf der Webseite des Filmfests mitproduziert.
Ein wichtiger Schachzug um internationale Prominente aus dem Film nach München zu holen, war der Cine Merit Award, mit dem das Festival Filmgrößen auszeichnet. Auf diese Weise konnten über die Jahre Stars wie Stanley Donen, Audrey Hepburn (Laudatorin für Donen), Susan Sarandon, Jules Dassin, Francesco Rosi, Marin Karmitz, Miloš Forman, Jacqueline Bisset, Manoel de Oliveira, Barbara Hershey u.v.a an die Isar geholt werden.

Was wären Filmfestivals ohne Stargäste? Durch verschiedenste Reihen und Retrospektiven gelang es ebenfalls, prominente Größen aus dem internationalen Filmgeschäft nach München zu holen. Zu den Gästen gehörten Quentin Tarantino, Robert De Niro, Robert Rodriguez, Salma Hayek, Otar Iosseliani, Spike Lee oder Jean-Luc Godard.