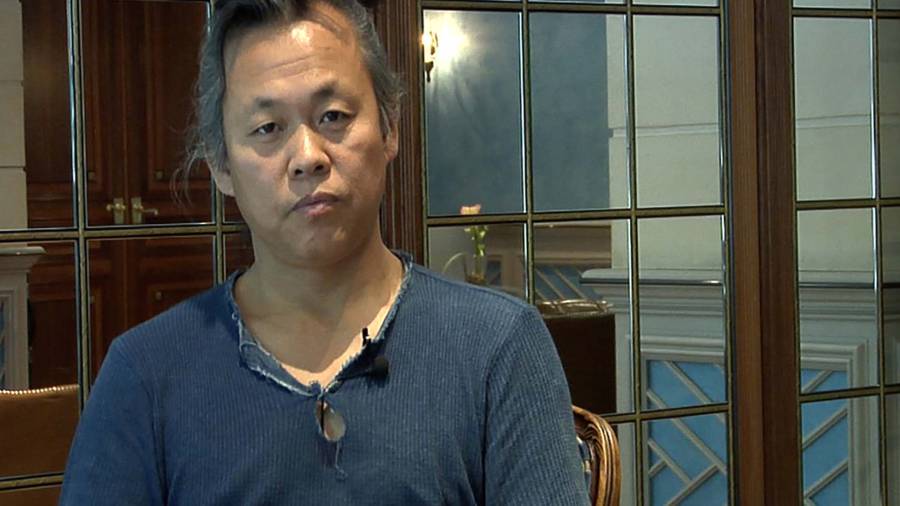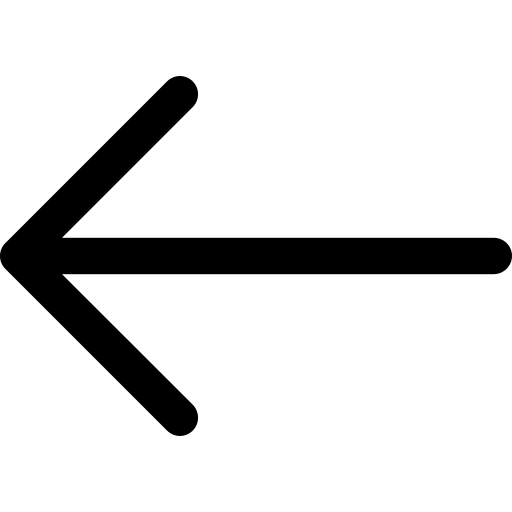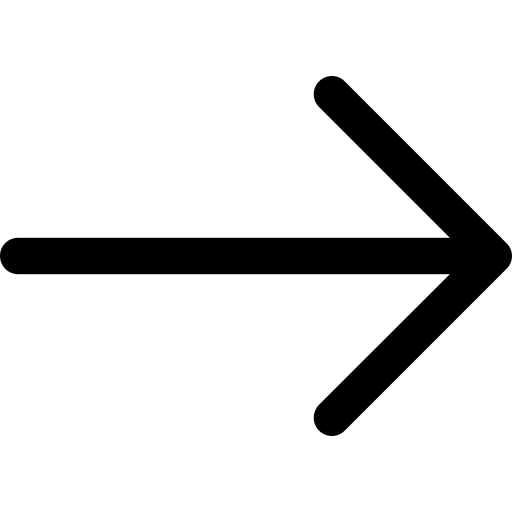Berlinale: Mees Peijnenburg
25 Februar 2026Mees Peijnenburg hat mit seinem Film "A Family" ein Trennungsdrama aus zwei höchst unterschiedlichen Perspektiven erzählt. Ein Interview.

Berlinale: Pieter Embrechts
24 Februar 2026Carice van Houten und Pieter Embrechts spielten die Eltern der beiden Kinder in "A Family". Im Interview spricht Pieter Embrechts über seine Arbeit in dem...

KI Müdigkeit beim Film
24 Februar 2026Das ging schnell, wie kam es dazu, dass das Publikum KI generierte Filme nicht mehr so interessant findet?

Berlinale: A Family Filmkritik
22 Februar 2026Was macht es mit Kindern, wenn ihre Eltern sich trennen? "A Family" erzählt davon sehr eindrücklich...